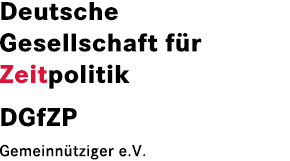Dr. Matthias Gockel
Zeitlichkeiten und Zeitkonflikte
rund um das Sterben
Einleitung
Palliativversorgung bedeutet weit mehr als nur die medizinische Begleitung schwerkranker Menschen. Sie ist ein Raum, in dem Zeit eine besondere Qualität erhält – eine Ressource, ein Geschenk, eine Herausforderung. Die Erfahrung von Zeit in der Palliativversorgung ist vielschichtig: Sie berührt Patient:innen, Angehörige und Fachpersonal auf existenzieller Ebene. Zeit ist nicht nur das Maß des verbleibenden Lebens, sondern auch das Medium, in dem sich Begegnung, Klärung und Abschied vollziehen. Im Folgenden möchte ich versuchen, verschiedene Dimensionen von Zeit in der palliativen Begleitung zu beleuchten.
Zeit für Aufklärung
Der Moment der Aufklärung über eine unheilbare Erkrankung oder das Eintreten einer palliativen Situation ist ein tiefgreifender Einschnitt. Heilung ist nicht (mehr) möglich, eine Rückkehr in das Leben „davor“ ausgeschlossen. Für Patient:innen bedeutet er eine Konfrontation mit ihrer Endlichkeit, oft Kontrollverlust und Angst. Die Zeit, die hier investiert wird, entscheidet maßgeblich darüber, ob diese existenzielle Information verstanden, angenommen und integriert werden kann.
Aufklärung in der Palliativversorgung braucht Ruhe, Geduld und vor allem Menschlichkeit. Standardisierte Gesprächsprotokolle können hier nur als Rahmen und Hilfe dienen – entscheidend ist die Fähigkeit des Gegenübers, einen geschützten Raum für offene Fragen, Emotionen und Schweigen zu schaffen. Zeit für Aufklärung ist damit nicht nur eine ethische Verpflichtung, die Voraussetzung für jede Form von mitmenschlicher Begleitung, sondern nimmt unmittelbar auch auf die Lebensqualität und Behandlung Einfluss, die oft unter Angst und fehlendem Wissen leidet.
Eine solche Aufklärung ist fast nie ein einmaliges Ereignis, sondern ein Prozess, der Wiederholungen, Pausen und mehrere Termine braucht, bis Unfassbares wirklich verstanden werden kann.
Aufklärung über Zeit
Neben der Aufklärung über die Krankheit selbst spielt auch die Aufklärung über Zeit eine zentrale Rolle: Wie lange bleibt noch? Was bedeutet „palliativ“ in Bezug auf Lebenszeit? Wie verändert sich die Zeitwahrnehmung im Sterbeprozess?
Der Rückzug auf Statistik hilft hier wenig, das Wissen über ein „medianes Überleben von x Jahren“ hilft weder Herrn Meier, der es nicht erreicht, aber in dem Vertrauen darauf vieles hinausgeschoben hat, noch Herrn Müller, der es weit überlebt, die Zeit aber mit Angst auf das imaginäre Datum verbracht hat.
Die Kunst besteht darin, offen und ehrlich zu kommunizieren, ohne zu entmutigen oder falsche Hoffnungen zu wecken. Aussagen wie „Niemand kann es genau sagen, lassen Sie uns auf das Beste hoffen, aber das Schlechteste einplanen“ oder „Wir sprechen hier eher von Wochen als von Monaten“ können Orientierung geben, ohne definitive Antworten vorzutäuschen.
Gleichzeitig sollten Wünsche und Pläne angesprochen werden – was ist noch wichtig, was soll noch gesagt, getan oder geregelt werden? Sind dies Dinge, die vielleicht auch ohne belastende Behandlungen erreicht werden können?
Die Auseinandersetzung mit der verbleibenden Zeit ist oft schmerzhaft, aber auch sinnstiftend. Viele Betroffene berichten von einer Verdichtung von Bedeutung, einer neuen Klarheit darüber, was zählt – ein Phänomen, das in der Palliativmedizin bewusst begleitet werden kann.
Zeiten der Klärung
Palliative Prozesse bieten – bei aller Schwere – auch Chancen zur Klärung: ungelöste Konflikte, offene Fragen, unausgesprochene Gefühle. Die Zeit „vor dem Tod“ kann zur Zeit der Wahrheit werden – wenn der Raum dafür gegeben ist.
Klärung braucht Vertrauen, Unterstützung und die Erlaubnis, auch das Unbequeme anzusprechen. Ob im Gespräch mit Angehörigen, im Schreiben eines letzten Briefes oder im klärenden Gespräch mit einer Seelsorgerin – solche
Prozesse dürfen nicht erzwungen, aber auch nicht verhindert werden. Das Zeitfenster für diese Schritte ist oft begrenzt, umso wichtiger ist es, frühzeitig Möglichkeiten zu eröffnen.
Für die psychosoziale und spirituelle Begleitung ergibt sich daraus eine wichtige Aufgabe: Räume schaffen, in denen Versöhnung möglich wird – mit anderen, mit dem Leben, mit sich selbst. Immer wieder kommt es auch in den letzten Tagen, wo „eigentlich schon alles gesagt war“, noch zu unerwarteten, fast magischen Momenten, die erst durch die Zeit, die hierfür gelassen wird, entstehen können.
Zeiten zum Sein
In einer Welt, die stark auf Tun und Funktionieren ausgerichtet ist, wirkt das „Sein“ oft wie ein Luxus. In der Palliativversorgung ist es jedoch essenziell. Zeiten zum Sein bedeuten: da sein, ohne zu handeln, ohne zu lösen, ohne zu optimieren. Sie bedeuten Nähe, Stille, Präsenz, gemeinsames Aushalten.
Solche Zeiten sind für Angehörige und Pflegekräfte oft herausfordernd – denn sie durchkreuzen die gewohnte Logik von Effizienz und Aktion. Doch gerade in den letzten Lebensphasen sind es oft diese stillen, unspektakulären Momente, die in Erinnerung bleiben: Eine Hand halten, gemeinsam schweigen, ein Lied hören, erinnern und davon erzählen.
Zeit zum Sein ist zutiefst menschlich – und gleichzeitig durch den Klinikalltag, der „ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich“ (§ 12 SGB 5) zu sein hat, permanent bedroht.
Zeiten für Abschied und Gehen
Das Sterben selbst ist ein Prozess, der seine eigene Zeitqualität hat. In der Palliativversorgung gilt es, dieser Zeit mit Achtung zu begegnen: Weder sie zu beschleunigen, noch künstlich zu verlängern, sondern sie so zu gestalten, dass Abschied möglich wird.
Abschied braucht Rituale, Worte, Berührung – und manchmal auch einfach nur das Einverständnis, dass es „gut ist, jetzt zu gehen“. Manche Menschen sterben schnell, andere langsam, manche allein, andere inmitten ihrer Liebsten. Jeder Abschied ist einzigartig, aber alle teilen die Notwendigkeit, Zeit dafür zu haben.
Das Personal in der Palliativversorgung ist oft Begleiter:in in diesen sensibelsten Stunden. Dies gilt umso mehr, als immer weniger Menschen Erfahrung mit dem Sterben haben und oft Hilfe bei den resultierenden Unsicherheiten benötigen.
Ihre Fähigkeit, präsent zu bleiben, zu halten und mitzutragen, ist von unschätzbarem Wert – und darf nicht vergessen machen, dass auch sie Zeit brauchen: für Selbstfürsorge, Verarbeitung und Trauer.
Zeiten der Trauer
Mit dem Tod eines Menschen endet nicht die Beziehung zu ihm. Die Trauer ist eine Zeit, in der der Verlust einen Platz finden muss im eigenen Leben – nicht um vergessen zu werden, sondern um integriert zu werden.
Auch hier gilt: Trauer hat keine feste Zeitvorgabe. Sie kann leise oder laut, kurz oder lang, unmittelbar oder zeitversetzt auftreten. In der Palliativversorgung endet die Begleitung idealerweise nicht mit dem letzten Atemzug. Angebote zur Trauerbegleitung – für Angehörige wie für das Personal – sind Zeichen von Kontinuität und menschlicher Tiefe.
Die Zeit der Trauer ist keine Krankheit, sondern ein gesunder Ausdruck von Liebe. Sie verdient Raum, Respekt und Geduld
Der bewusste Umgang mit dem Sterben erinnert uns daran, dass Zeit nicht nur vergeht – sie kann auch geschenkt werden. Und vielleicht ist das das Kostbarste, was wir einander geben können.
Zeit als Kostenfaktor im modernen (DRG-gesteuerten) Krankenhaussystem
In einer DRG 1-gesteuerten Krankenhauslandschaft wird (Personal)Zeit zunehmend als wirtschaftlicher Faktor betrachtet: kalkuliert, bepreist, begrenzt und oft am
einfachsten „einsparbar“, zwei Pflegekräfte statt drei, 15 Patienten statt 10 pro Mitarbeiter. Dies steht in frappierendem Gegensatz zur Zeitlichkeit in der Palliativversorgung, die oft Offenheit, Flexibilität und Langsamkeit erfordert.
Wenn das Gespräch mit einem Sterbenden „nicht abgerechnet werden kann“, aber essenziell für dessen Würde ist, gerät das System an seine ethischen Grenzen. Die Realität vieler Palliativstationen ist ein ständiger Spagat: zwischen wirtschaftlichen Vorgaben und menschlichen Bedürfnissen, in der die Würde vom Rückgrat der Mitarbeiter abhängt.
Es braucht politische und strukturelle Veränderungen, damit Zeit in der Palliativversorgung nicht zum „Luxusgut“ wird, sondern als Grundvoraussetzung für würdiges Sterben anerkannt bleibt. Denn wie wir mit der Zeit am Lebensende umgehen, sagt viel darüber aus, wie wir als Gesellschaft Menschsein verstehen.
Dr. Matthias Gockel,
Facharzt für Innere Medizin, Schwerpunkt Palliativmedizin am Sana Klinikum Berlin-Lichtenberg

Bei seiner Arbeit erlebt der Internist und Palliativmediziner Matthias Gockel täglich, wie sehr Verdrängen und Verschweigen einen bewussten Umgang mit dem Sterben erschweren. Das betrifft alle Beteiligten – die schwer erkrankten Menschen, die Angehörigen und Freunde, die Ärztinnen und Ärzte, das pflegende Personal. Deshalb will Matthias Gockel das Sterben im Krankenhaus erträglicher machen. Sein Buch „Sterben – Warum wir einen neuen Umgang mit dem Tod brauchen“ erschien kurz vor Ausbruch der Corona-Epidemie und benannte eine Problemlage, die plötzlich auf die Spitze getrieben wurde. Was damals in aller Öffentlichkeit breit diskutiert wurde, droht nach der Rückkehr in den „Normalzustand“ wieder zu versanden. Gockel arbeitet weiter an der Verbesserung der palliativen Betreuung und benennt konkret, was dem entgegensteht.
- diagnosebezogene Fallgruppierung ↩︎