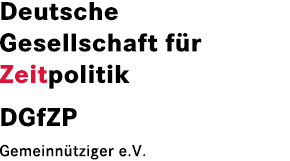Werner Schiewek
„Plötzlich und unerwartet … –
Der plötzliche Tod aus polizei(seelsorg)licher Perspektive
Einleitende Gedanken
Der Tod gehört zu den wenigen Gewissheiten des Lebens. Diese abstrakte Aussage ist eine Binsenweisheit. Aber je konkreter sie sich in der eigenen Erfahrung realisiert, sei es durch Todesfälle im sozialen Umfeld, sei es als Furcht vor dem eigenen Tod, desto bedrängender wird diese Realität. Während das „Das“ des Todes somit als existenzielles Faktum unverrückbar feststeht, ist sein konkretes „Wann“ eine tendenziell offene Frage. Als grundsätzliche Möglichkeit wäre die Antwort darauf schlicht „Jederzeit“, was eine Folge der grundsätzlichen Vulnerabilität des Lebens ist. Die soziale Erwartung hofft in der Regel auf ein langes Leben, was aufgrund der seit Jahrzehnten höher werdenden Lebenserwartung auch gut begründet ist. Sie liegt aktuell in Deutschland bei 78,2 Jahren bei Männern und bei 83 Jahren bei Frauen. Vor allem Alter (im Jahr 2023 waren über 86 % aller Verstorbenen älter als 65 Jahre) und Krankheit sind zwei Faktoren, die auf die Erwartbarkeit des „Wann“ des Todes einwirken. Sie versorgen uns mit vagen Wahrscheinlichkeiten und daraus abgeleiteten Fristen, die ein „Damit-Rechnen“ oder ein „Sich-darauf-Einstellen“ zumindest ermöglichen. Ein sogenannter „plötzlicher Tod“ ist demgegenüber ein anzeichenloser und völlig unerwarteter Lebensabbruch. Er ist nur lose mit dem Alter verbunden, d. h. auch hochaltrige Menschen versterben „plötzlich und unerwartet“, wie entsprechende Traueranzeigen es dokumentieren. Die Unmöglichkeit, konkrete Erwartungen dem plötzlichen Tod gegenüber auszubilden, macht seine Besonderheit aus. Er stellt das Leben aller Betroffener von jetzt auf gleich auf den Kopf – als Abbruch des Lebens für den Toten und als massive Erschütterung des Beziehungsnetzwerkes, in dem er oder sie nun plötzlich fehlt.
In den folgenden Ausführungen möchte ich auf die Häufigkeit, die möglichen Ursachen und auf die Auswirkungen des plötzlichen Todes näher eingehen und einige sich daraus ergebende individuelle und gesellschaftliche Herausforderungen skizzieren.
Zum Begriff „plötzlicher Tod“
Der plötzliche Tod kann auf innere (natürliche) oder äußere (nichtnatürliche) Umstände zurückgeführt werden (vgl. Thieme 2019, S. 21-24). Zu den inneren Ursachen eines plötzlichen Todes zählt der plötzliche, d. h. sofortige oder innerhalb von 24 Stunden nach dem Auftreten der ersten Symptome eintretende Herztod (PHT). Er stellt eine der häufigsten Todesursachen weltweit dar. Können zwar innere Ursachen vermutet, aber keine konkreten festgestellt werden, spricht die WHO 1 von einem „sonstigen plötzlichen Tod unbekannter Ursache“ (ICD-11, MH12). Als besonders tragischer Fall eines solchen Todes kann der sogenannte plötzliche Säuglings- oder Kindstod gelten (SIDS – Sudden Infant Death Syndrome; ICD-11, MH11), der in den letzten drei Jahrzehnten zwar um über 90 % zurückgegangen ist, von dem aber immer noch 83 Säuglinge im Jahr 2023 in Deutschland betroffen waren. 2 Demgegenüber stehen diejenigen plötzlichen Todesfälle, die sich auf „äußerliche Ursachen“ zurückführen lassen. Hier ist an jegliche Form von Unglücksfällen (z. B. Verkehrsunfälle, Unglücksfälle im Haushalt oder im Betrieb, Ersticken oder Ertrinken, Todesfälle aufgrund von höherer Gewalt: Blitzschlag, Erdbeben, Lawinen) oder von absichtlich herbeigeführten Todesfällen durch menschliches Einwirken (z. B. Suizid, Körperverletzung mit Todesfolge, Mord) zu denken.
Aufgrund der Vielzahl der Möglichkeiten eines plötzlichen Todes stellt sich die Frage, ob er insgesamt gesehen ein häufiges oder seltenes Phänomen in unserer Gesellschaft darstellt.
Epidemiologie des plötzlichen Todes
Laut der Erhebungen des Statistischen Bundesamtes starben 2023 knapp über 1 Million Menschen in Deutschland (d. h., es gab 1217 Sterbefälle je 100.000 Einwohner). Der plötzliche Tod stellt keine eigene statistische Kategorie in der Demografie dar, sodass er aus den Todesursachen indirekt abgeleitet werden muss. Im Hinblick auf die inneren Ursachen sollen für eine erste grobe Einschätzung zumindest die Todesursachen „Akuter Myokardinfarkt“ (43.839 Todesfälle 2023) sowie „Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt gekennzeichnet“ (9.715 Todesfälle 2023) als Indikatoren genutzt werden, wobei ein Unsicherheitsfaktor im Hinblick auf mögliche Vorbefunde in Rechnung gestellt werden muss. Daraus ergibt sich ein möglicher Anteil von 5 – 6 % von innerlich verursachten plötzlichen Todesfällen an allen Todesfällen. Etwas besser steht es um Erfassung äußerlich verursachter plötzlicher Todesfälle, die unter der Sammelkategorie „Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität“ aufgeführt werden.3 Dort finden sich für das Jahr 2023 insgesamt 49.396 Todesfälle, was einem Anteil von 4,8 % an der Gesamtzahl entspricht. Summiert man beide Kategorien, dann ergibt sich ein Anteil von ca. 10 % plötzlicher Todesfälle an der Gesamtzahl jährlicher Todesfälle, wobei diese Zahl je nach Kategorienschärfe und Detaillierungsgrad der statistischen Daten allerdings nur eine grobe Orientierung bieten kann.4 Das heißt: Ein plötzlicher Tod ist zwar nicht die Regel, aber auch keine seltene Ausnahme. Was im Hinblick auf den plötzlichen Tod jedoch wirklich als Ausnahme bezeichnet werden kann, ist der Tod infolge eines tätlichen Angriffs, oder wie die entsprechende ICD-10 Klassifizierung heißt: Der Tod infolge einer „Tötung / Verletzung durch eine andere Person in Verletzungs- oder Tötungsabsicht auf jede Art und Weise“. Massenmedial sehr präsent hat dieser gewaltsame plötzliche Tod jedoch „nur“ einen Anteil von 0,34 % an den zuvor erhobenen plötzlichen Todesfällen. Demgegenüber haben Suizide einen Anteil von 10 %, Stürze einen Anteil von über 20 %.
Auswirkungen des plötzlichen Todes
Die Plötzlichkeit eines natürlichen oder nichtnatürlichen Todes führt aufseiten der „Kreise der Betroffenheit“ (Lebenspartner:in, Kinder, Eltern, Geschwister, weitere Verwandte, Freundeskreis, Arbeitskolleg:innen, Nachbarschaft, weitere Bekannte via Gruppen, Vereinen, Parteien, Kirchengemeinde etc.) je nach sozialer und emotionaler Nähe zu unterschiedlichen Reaktionen. Sie reichen vom existenziellen Schock und einem möglichen Zusammenbruch bis hin zur schlichten sachlichen Kenntnisnahme. Darüber hinaus kommen beim plötzlichen Tod aber auch weitere professionelle Beteiligte ins Spiel, die gerade durch das Moment „Plötzlichkeit“ aktiviert werden. Dazu gehören in der Regel Rettungskräfte, Ärzte und sehr oft auch die Polizei. Letztere wird vor allem dann tätig, wenn ein plötzlicher Tod im öffentlichen Raum stattgefunden hat. Hier stellen sich häufig Fragen der Identitätsfeststellung des bzw. der Verstorbenen und die Aufgabe der zeitnahen Benachrichtigung der nächsten Angehörigen, der sogenannten „Überbringung von Todesnachrichten“. Darüber hinaus ist für das Tätigwerden der Polizei die Todesursache von entscheidender Bedeutung. Bleibt sie unklar, dann besteht die polizeiliche Aufgabe darin, eine mögliche Fremdeinwirkung aufzuklären. Steht die Todesursache fest und fällt der plötzliche Tod damit in die Kategorie „nicht natürlicher Tod“ (was z. B. bei Unfällen und Gewaltdelikten der Fall ist), dann ergeben sich für die Polizei zwei Aufgaben. Als erstes wird sie im Rahmen der sogenannten „Gefahrenabwehr“ versuchen, eventuell akut drohenden weiteren Schaden zu verhindern z. B. bei Verkehrsunfällen oder Großschadenslagen. Dann wird sie zweitens im Rahmen ihres Strafverfolgungsauftrags tätig werden, um die Todesumstände weiter aufzuklären und mögliche Verantwortliche namhaft zu machen.
Schon diese Hinweise machen deutlich, dass die professionelle Rolle der Polizei beim plötzlichen Tod infolge äußerlicher Verursachung von besonderer Bedeutung ist. Niemand kann „gegen den plötzlichen Eintritt des Todes eine allumfassende Vorsorge treffen“, und auch der Staat kann auf institutioneller Ebene keine solche gewährleisten (Anderheiden 2012, S. 229 Anm. 47). Aber der Staat kann von jetzt auf gleich (die Polizei spricht hier zum Beispiel von „Sofortlagen“) professionelle Handlungsressourcen aktivieren wie z. B. Rettungsdienste und Polizei.
Gerade die Polizei ermöglicht es, den plötzlichen Tod eines Menschen in sachlicher (Was ist passiert?), sozialer (Wer ist wie betroffen?) und zeitlicher (Wann geht es wie weiter?) Perspektive 5 beschreibbar und so vielleicht auch in Ansätzen hinsichtlich seiner Ursachen und Auswirkungen verstehbar werden lassen. Menschen benötigen die Herstellung solcher „Verstehbarkeiten“, sowohl diejenigen im engeren Umkreis des bzw. der Verstorbenen als auch die Gesellschaft als ganze, um mit dem potenziell traumatischen Ereignis eines plötzlichen Todes umgehen zu können. Inwiefern er „bewältigt“ werden kann, ist eine offene Frage. Hinsichtlich der Zeitdimension besteht die traumatische Qualität eines plötzlichen Todes vor allem darin, ob und wie es nach einem daraus resultierenden „Einfrieren“ bzw. „Stillstehen der Zeit“ 6 überhaupt „weitergehen“ kann. Im Hinblick auf die Sachdimension lässt sich unter Rekurs auf die kognitive Traumatheorie von Ronnie Janoff-Bulmann (1992) konstatieren, dass durch den plötzlichen Tod eines oder vieler Menschen eine oder mehrere der vier psychischen Grundannahmen fundamental erschüttert werden, die für das menschliche Leben basal sind: (1.) Ich bin unverletzlich/unverwundbar, (2.) ich bin wertvoll, (3.) ich kann Menschen vertrauen, (4.) ich kann die Welt verstehen. 7 Der Tod stellt grundsätzlich diese Grundannahmen infrage. Der plötzliche Tod verschärft diese Infragestellung. Beim absichtlich oder fahrlässig durch Menschen verursachten plötzlichen Tod („human made“) betrifft dies die dritte Grundannahme. Bei Unglücksfällen steht vor allem die vierte Grundannahme zur Disposition. Kann die tiefgreifende Verunsicherung dieser Basisannahmen nicht wieder auf ein erträgliches Maß reduziert werden, sondern sind sie dauerhaft und tiefgreifend fraglich geworden, dann ist ein schwerer Schaden für das individuelle Leben (individuelles Trauma), aber unter Umständen auch für die Gesellschaft als Ganzer (kollektives Trauma) eingetreten. Durch daraus resultierende dysfunktionale Reaktionen auf individueller oder gesellschaftlicher Ebene ist über den weiteren Zeitverlauf hinweg sogar noch mit weiteren Schädigungen zu rechnen.
Selbst bei einem professionellen Umgang mit dem plötzlichen Tod, wie z. B. durch die Polizei, sind diese Belastungen und Gefährdungen stets präsent. Vier Aspekte sollen hier kurz genannt werden. Erstens das unmittelbare Erleben der Umstände plötzlicher Todesfälle, z. B. durch die jeweiligen „Auffindesituationen“, in denen die polizeiliche Aufgabe gerade darin besteht, genau hinzusehen und eben nicht wegsehen zu dürfen. Eine zeitlich induzierte Belastung besteht in diesen Zusammenhängen grundsätzlich darin, immer „zu spät“ zu kommen, sodass eine Rettung (oder in polizeilicher Sprache: ein „Vor-die-Lage-Kommen“) nicht mehr möglich ist. Zweitens die zuvor schon genannte Mitteilung bzw. Überbringung der Nachricht eines plötzlichen Todes. Sie gehört zu den am meisten belastenden Aufgaben im Polizeiberuf. Eine zeitlich induzierte Belastung besteht in diesem Zusammenhang zunehmend darin, mit der Informationsgeschwindigkeit sozialer Netzwerke und anderer digitaler Medien „mithalten“ zu können. Denn immer öfter werden ungesicherte Informationen und manchmal auch schockierendes Bildmaterial in „Echtzeit“ verbreitet und erreichen die Angehörigen vor der Information durch die Polizei. Drittens gehört unter Umständen auch das Zufügen eines plötzlichen Todes zum polizeilichen Handeln, z. B. in Form der Notwehr zum Schutz des eigenen Lebens oder als sogenannter „finaler Rettungsschuss“ als letztes Mittel zur Rettung eines Lebens im Rahmen der Nothilfe. 8 Ein unmittelbar zeitlicher Aspekt liegt in der „Zeitverdichtung“ solcher Situationen, die manchmal extrem schnelle Entscheidungen in hochdynamischen und komplexen
Situationen erfordern. Viertens gibt es schließlich auch das Erleiden des plötzlichen Todes in den Reihen der Polizei, äußerlich verursacht z. B. durch Tätereinwirkung, Unfall oder Suizid, oder innerlich verursacht wie z. B. durch den schon erwähnten plötzlichen Herztod. Solche Vorfälle belasten auch eine professionell mit plötzlichen Todesfällen umgehende Organisation sehr stark und kann sie manchmal auch an die Grenzen ihrer Professionalität bringen.9 Im Rahmen der drei zuvor genannten Stressreaktionen sieht die Polizei ihre Professionalität gerade darin, sich schwierigen Situationen zu stellen und sie zu bewältigen. Das bedeutet, wo immer möglich die Option „Fight“ gegenüber „Freeze“ und „Flight“ vorzuziehen. Daraus resultiert beim plötzlichen Tod in den eigenen Reihen eine organisationsinterne zeitliche Spannung. Einerseits gibt es einen partiellen organisationsinternen „Zeitstillstand“ aufgrund unmittelbarer persönlicher Betroffenheiten von Kolleg:innen. Andererseits trifft er auf eine organisationale „Zeitknappheit“, weil auch bei plötzlichen Todesfällen in den eigenen Reihen die polizeiliche Aufgabe darin besteht, auch in diesen Fällen schnell und umfassend tätig zu werden.
Ein (kurzes) Resümee
Ein plötzlicher Tod mag aus persönlicher Sicht vielleicht wünschenswert sein. So verweist Hoffmann (2011) auf Umfragen, bei denen fast 80 % der Befragten sich einen solchen wünschen. Aber für alle Zurückgebliebenen stellt er in der Regel eine extrem große Herausforderung und nicht selten auch eine (temporäre) Überforderung dar. Diese resultieren in sozialer Hinsicht aus dem Überwältigungscharakter eines plötzlichen Todes, der die persönlichen und sozialen Verarbeitungskapazitäten überfordert und damit einhergehende Traumatisierungsrisiken in sich birgt. Das brutale Faktum lautet: Alles ist anders geworden. Und: Es gibt kein Zurück zum Vorher. Gleichzeitig zeigt sich eine Brutalität des sozialen Lebens darin, dass das Leben, das eigene und auch das des sozialen Umfeldes, trotzdem – einfach – weitergeht. Auch Organisationen funktionieren – einfach – weiter.10 Schließlich kommt gerade bei äußerlich verursachten plötzlichen Toden der zu klärenden Schuldfrage eine große Bedeutung zu. Ihre Klärung ändert zwar nichts am reinen Faktum eines plötzlichen Todes, ermöglicht aber ex post eine Stabilisierung der fraglich gewordenen Basisannahmen zwei bis vier. Hier erweist sich die Arbeit von Polizei, Staatsanwaltschaft und Justiz als besonders wichtig und ist für viele Betroffene hilfreich.
Darüber hinaus verbinden sich zeitliche Herausforderungen mit dem plötzlichen Tod. Besonders hier werden Asymmetrien des Zeiterlebens leidvoll spürbar, die in
ihrer Gleichzeitigkeit und dem sich daraus ergebenden Nebeneinander nur schwer auszuhalten sind. Dazu gehört der unvermittelte Abbruch eines Lebens, der von den Zurückbleibenden häufig als Zeitstillstand, Zeitimplosion inmitten der Normalzeit erfahren wird. Dazu gehört auch der plötzliche Zusammenbruch erwarteter Zukünfte, der sich individuell als Hoffnungsverlust und kaum zu kittender Riss im sozialen Gefüge zeigen können. Schließlich zeigt sich ein je individueller Bedarf an Trauerzeit. Diese sieht sich als eine Form der Eigenzeit im Gegenüber zu den von Organisationen und Gesellschaften kontrollierten Zeiten (und Orten) von Trauer (vgl. Smeding & Ewald 2020). Diese individuelle Trauerzeit sucht und braucht „plötzlich und unerwartet“ einen ihr gemäßen Ort, der ihr aber häufig nicht konfliktlos zugestanden wird.
Literatur
Anderheiden, Michael (2012): Die Menschenwürde beim Sterben erhalten: Rechtliche Bedingungen. In: Ders. & Eckart, Wolfgang Uwe (Hg.): Handbuch Sterben und Menschenwürde – Band 1. Berlin, Boston: De Gruyter, S. 213-236.
Hoffmann, Matthias (2011): „Sterben? Am liebsten plötzlich und unerwartet“. Die Angst vor dem „sozialen Sterben“. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Helmchen, Hanfried & Lauter, Hans (2009): Krankheitsbedingtes Leiden, Sterben und Tod aus ärztlicher Sicht. In: Klinger, Cornelia (Hg.): Perspektiven des Todes in der modernen Gesellschaft (Wiener Reihe – Themen der Philosophie; Bd. 15). Wien/Berlin: Böhlau Verlag/Akademie Verlag, S. 145-182.
Janoff-Bulman, Ronnie (1992): Shattered assumptions. Towards a new psychology of trauma. New York [u.a.]: Free Press.
Kustor, Beatrice & Garwood, Alfred (2024): Traumatische Prozesse bei Individuen, Gruppen und in sozialen Systemen. In: gruppenanalyse 34/2, S. 9-28.
Luhmann, Niklas (1987): Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Smeding, Ruthmarijke & Ewald, Hermann (2020): Tauer-Zeit: Zeit der Trauer oder Zeit zum Trauern? In: Ewald, Hermann & Vogeley, Kai & Voltz, Raymond (Hg.): Palliativ & Zeiterleben. Stuttgart: W. Kohlhammer, S. 151-171.
Thieme, Frank (unter Mitarbeit von Julia Jäger) (2019): Sterben und Tod in Deutschland. Eine Einführung in die Thanatosoziologie. Wiesbaden: Springer VS.
Trappe, Tobias (Hg.) (2012): Die Polizei und der Tod. Geschichten und Gedanken zu einer Über-Lebens-Frage (Ethik der öffentlichen Verwaltung – Schriftenreihe der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung; Bd. 2). Frankfurt am Main: Verl. für Polizeiwissenschaft.
Unrath, Christine (2012): ‚‘… das lässt keinen kalt‘‘: Polizei als Zeuge des Sterbens/als Überbringer der Todesbotschaft. In: Anderheiden, Michael & Eckart, Wolfgang Uwe (Hg.): Handbuch Sterben und Menschenwürde – Band 2. Berlin, Boston: De Gruyter, S. 1243-1262.
Werner Schiewek war von 2001 bis 2023 als Lehrbeauftragter des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) für Ethik im Polizeiberuf an der Deutschen Hochschule der Polizei (DHPol) in Münster Hiltrup tätig. Gleichzeitig war er geschäftsführender Pfarrer im Landespfarramt für den Kirchlichen Dienst in der Polizei der Evangelischen Kirchen von Westfalen (EKvW).
- So in der „International Classification of Diseases 11th Revision“, ICD-11, Abschnitt für Mortalitäts- und Morbiditätsstatistiken (MMS). ↩︎
- Statistisches Bundesamt. (15. April, 2025). Anzahl der plötzlichen Kindstode in Deutschland im Zeitraum von 1980 bis 2023 [Graph]. In Statista. Zugriff am 10. Mai 2025, von https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1260562/umfrage/ploetzliche-kindstode-in-deutschland/ Darüber hinaus wären auch totgeborene Kinder zu berücksichtigen. ↩︎
- Im Einzelnen handelt es sich für das Jahr 2023 um Transportmittelunfälle (Verkehrsunfälle): 3.106 Tote; Stürze: 20.845 Tote; Unfälle durch Ertrinken und Untergehen: 465 Tote; Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen: 283 Tote; Vorsätzliche Selbstschädigung (Suizid): 10.304 und tätlicher Angriff: 329 Tote. ↩︎
- Für das Jahr 2005 sprechen Helmchen & Lauter (2009, S. 151) von einem Anteil plötzlicher Todesfälle am Gesamt aller Sterbefälle von weniger als einem Siebtel, d. h. von ca. 14%. ↩︎
- So in Anlehnung an die drei Sinndimensionen nach Niklas Luhmann (1987, S. 112-135). ↩︎
- Das sogenannte „Freeze“ ist eine der möglichen Reaktionen gegen traumatischen Stress neben den dazugehörigen Alternativen Fight oder Flight – Kämpfen oder Flüchten. Zu diesen Reaktionen vgl. Kustor & Garwood 2024, S. 12-17. ↩︎
- Wir wissen natürlich darum, dass diese Grundannahmen in dieser Form nicht zutreffen, trotzdem scheinen wir alltagsmäßig implizit davon auszugehen und dementsprechend zu leben, als ob sie zuträfen. So wird z. B. durch das Abfassen sogenannter „Pflichttestamente“ vor polizeilichen oder militärischen Auslandseinsätzen aus einem eher wenig belastenden abstrakten Wissen um die eigene Sterblichkeit eine als teilweise sehr belastend erlebte existenzielle Erfahrung, die persönlichen letzten Dinge nun ganz konkret regeln zu sollen. ↩︎
- Was erfreulicherweise ein doch seltenes Ereignis darstellt. So wurden im Jahr 2024 zweiundzwanzig Menschen durch Polizisten erschossen (im Jahr 2023 zehn), in den USA 1.173 (2024) bzw. 1.163 (2023). Aktuelle und detaillierte Zahlen für Deutschland werden von Clemens Lorei auf seiner Internetseite www.schusswaffeneinsatz.de gesammelt und dargestellt. ↩︎
- Zu den vielen Facetten zum Erleben und Umgang mit dem Tod in der Polizei, auch über den Tod in den eigenen Reihen hinaus, vgl. Trappe 2012 sowie Unrath 2012. ↩︎
- Um die nicht gewollte, aber trotzdem so wahrnehmbare Brutalität im Fall von Organisationen etwas fühlbar zu machen: Für Organisationen stellt der plötzliche Todesfall eines Mitarbeitenden ein Organisationsproblem dar, dass heißt, es geht um die Besetzung einer frei gewordenen Stelle und bis zu deren Besetzung um die Frage, wer die entsprechende Arbeit übernimmt. ↩︎