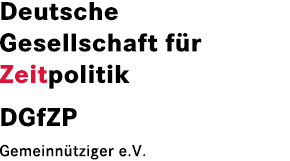Lukas Heck
Lebensverlängerung als gesellschaftliches Projekt?
Wie können wir ewig leben? Diese Frage beschäftigte bereits die antike Philosophie und Medizin – nicht nur im Hinblick auf das gute Leben, sondern auch auf die Möglichkeit (oder Unmöglichkeit) der Unsterblichkeit. Heute gewinnt das Streben nach einem längeren Leben, oft unter dem Schlagwort „Longevity“, durch neuartige Lifestyle-Trends eine neue Relevanz. Dieser Beitrag wird zunächst einen Einblick in die Longevity-Bewegung geben. Darauf aufbauend werde ich anhand von vier Thesen zentrale Problemstellungen dieses Ansatzes diskutieren. Abschließend gehe ich auf Bedingungen und Ausgangspunkte einer „Lebensverlängerung als gesellschaftliches Projekt“ ein.
Die Longevity-Bewegung ist keine einheitliche Bewegung im klassischen Sinne, sondern ein Netzwerk von Ideen, Akteur:innen und Unternehmen. Was sie eint, ist ein Grundgedanke: In Anlehnung an die populärwissenschaftliche Philosophie des Nobelpreisträgers Elie Metchnikoff wird das Altern nicht mehr als unausweichlicher, natürlicher Prozess verstanden, sondern als behandelbare „Krankheit“. Damit verschiebt sich der Blick auf den Tod: Er dient nicht länger als ein existenzieller Orientierungspunkt, der das Leben strukturiert und uns zu Entscheidungen bewegt. Stattdessen wird er zu einem Problem, das es zu verzögern, zu kontrollieren oder gar zu überwinden gilt. Die Longevity-Bewegung verbindet damit alte Menschheitsträume mit neuen Technologien, medizinische Visionen mit ökonomischen Interessen.
Geprägt wird der Lifestyle-Trend durch Figuren wie den amerikanischen Unternehmer und Tech-Millionär Bryan Johnson, der sich seit 2021 selbst zum Bio-Experiment gemacht hat (Projekt „Blueprint“). Unter der Maxime „Don’t die“ verfolgt er das Ziel, sein biologisches Alter systematisch zurückzusetzen. In einer zweiteiligen ARD-Reportage des Y-Kollektivs („Unsterblich“) rät Johnson dem Journalisten zu vier Grundpfeilern für ein längeres Leben: geregelter Schlaf, tägliche Bewegung, gesunde Ernährung und der Verzicht auf schädliche Gewohnheiten. Diese Devisen sind in der Gesundheitsprävention weit verbreitet. Doch unter dem Deckmantel der vermeintlichen Übertragbarkeit werden sie in der Longevity-Bewegung deutlich extremer ausgelebt, interpretiert und zugespitzt:
- Von Prävention zu Optimierung: Vertreter:innen der Longevity-Bewegung erwirken einen Paradigmenwechsel. Der Körper ist eine optimierbare Plattform. Der Tagesablauf folgt einer klar festgelegten Struktur, der sich als optimaler Plan gegen die Zellalterung stellt. Gesundheitsrisiken werden im Alltag vollständig gemieden. Lediglich Schlaf, Ernährung und Sport reichen nicht – Ziel ist die Kontrolle über das Altern.
- Disziplin durch Technologie: Ein zentraler Orientierungspunkt für optimale Entscheidungen zur Selbstoptimierung ist die Praktik der Selbstvermessung. Vertreter:innen verschreiben sich der Idee des Quantified Self, die mithilfe neuer Technologien den eigenen Körper messbar macht: Apps, digitale Armbänder, Implantate und digitale Aufzeichnungstools wandeln körperliche und seelische Zustände in Daten (Mau 2018). Beispielsweise werden die Nutzer:innen durch festgelegte Normwerte – etwa eine maximale Kalorienzufuhr – zur Selbststeuerung angeleitet und in ihrem Verhalten konditioniert. Überschreitungen werden durch unmittelbare Handlungsaufforderungen reguliert.
- Exklusivität: Die tägliche Einnahme zahlreicher Nahrungsergänzungs- und anderer Präparate zur Vorbeugung von Zellalterung ist ein zentrales Element vieler Longevity-Programme – und verdeutlicht, dass der Zugang zu solchen Maßnahmen in hohem Maße von finanziellen Ressourcen abhängt. In den USA entstehen zugleich spezialisierte Longevity-Zentren, die umfassende Gesundheitsdiagnosen und individuell zugeschnittene Präventionspläne anbieten. Auch diese Einrichtungen sind nur einem exklusiven Publikum vorbehalten, da sie auf regelmäßige, kostenintensive Termine setzen.
Die enge Verflechtung von Selbststeuerung mit digitalethischen und medizinethischen Fragen wird kaum in der öffentlichen Debatte thematisiert. Im Silicon Valley hat sich hingegen längst eine Szene etabliert, in der Tech-
Milliardäre, Start-ups und Forschungseinrichtungen
gezielt an Longevity arbeiten. Altern wird dort nicht mehr als Bestandteil menschlicher Existenz verstanden, sondern zunehmend als technisch lösbares Problem – und damit der menschlichen Konstitution entzogen. In vier Thesen möchte ich die Beweggründe dieser Szene befragen:
These 1: Lebenstempo ersetzt Jenseits
Wer glaubt noch an ein Leben nach dem Tod? Die fortschreitende Säkularisierung der Gesellschaft schwächt nicht nur religiöse Institutionen, sondern entzieht auch der Vorstellung eines Jenseits zunehmend ihre kulturelle Tragkraft. Damit geht der Glaube verloren, in ein größeres Ganzes eingebettet zu sein und die Endlichkeit des irdischen Lebens als Teil einer übergeordneten Ordnung zu begreifen. An die Stelle der Vorstellung des Lebens auf der Erde als ersten Schritt einer größeren Einbettung tritt eine eindimensionale, lineare Zeitlogik, welche sich mit individuell-libertären Vorstellungen paart. Diese Entwicklung begünstigt eine Haltung, die eigene Lebenszeit nach Kriterien der Effizienz, Verdichtung und Steigerung innerweltlich möglichst sinnvoll zu füllen (Rinderspacher 2002).
These 2: Unvereinbarkeit von ökologischen Krisen mit dem Longevity-Lebensstil
Nicht nur in Zukunft, sondern bereits heute zeigt die Klimakrise katastrophale Folgen – etwa in der Zunahme von Extremwetterereignissen. Wer trägt überproportional zur Klimakrise bei? In der Forschung rückt der Zusammenhang zwischen globaler Ungleichheit und ökologischen Katastrophen in den Fokus. Die Verteilungsfrage von Vermögen wird dabei verstärkt als zentrales Problem thematisiert (Chancel et al. 2025). Für die Mehrheit der Weltbevölkerung bedeutet die Zukunft angesichts multipler Krisen eher eine Lebensverkürzung. Anhaltende Krisen werden sich nicht nur auf die Lebenserwartung, sondern auch auf die Lebensqualität auswirken – insbesondere bei jüngeren Generationen wächst die mentale und physische Belastung in Form zunehmender Zukunftsängste und psychischer Erkrankungen.
These 3: Die schöne neue Welt als Zeitkultur
Aktuelle Debatten über Lebensverlängerung werden maßgeblich von Befürworter:innen eines technikzentrierten Fortschrittsgedankens dominiert. Sie setzen auf Zukunftstechnologien, um die natürlichen zeitlichen Grenzen des menschlichen Lebens zu überwinden. Ein Fortschrittsethos wird kultiviert, das die technologische Machbarkeit über die gesamtgesellschaftliche Relevanz stellt. Ökologische Rebound-Effekte und die materielle Grundlage digitaler Infrastrukturen (in puncto Energieverbrauch oder der problematischen Gewinnung seltener Erden) bleiben außer Acht. Dazu zwei Beispiele:
Erstens steht die Longevity-Bewegung in enger ideeller Verbindung zur Trans- und Posthumanismus-Bewegung. Der Mensch wird hier nicht als abgeschlossenes Wesen verstanden, sondern als ein optimierbares Projekt – eines, das sich mithilfe technologischer Mittel gezielt weiterentwickeln soll – jenseits biologischer Grenzen. Der körperliche Zerfall soll nicht länger hingenommen, sondern durch technologische Innovationen – etwa künstliche Organe oder digitale Erweiterungen – kompensiert oder gar aufgehoben werden, als Human Enhancement (Möck & Loh 2022). Damit rückt die Vision einer Verbindung von Mensch und Maschine näher und wirft ethische Fragen über das Menschsein, Identität und Endlichkeit auf.
Zweitens findet Longevity auch Eingang in die politische Arena. Bei den EU-Wahlen 2024 trat in Deutschland erstmals die „Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung“ an, eine Ein-Themen-Partei für Longevity. Ihr zentrales Anliegen: Der Aufbau einer Industrie, die mithilfe von Zukunftstechnologien eine Verjüngungsmedizin entwickelt und so den Herausforderungen einer alternden Gesellschaft begegnet. Ein Beispiel dafür ist die Kryonik: Verstorbene werden unmittelbar nach dem klinischen Tod eingefroren und konserviert, in der Hoffnung, dass künftige medizinische Fortschritte eine Wiederbelebung ermöglichen. Zentrale Fragen bleiben offen: Wie hoch ist der Ressourcen- und Energieverbrauch der Technologien? Inwieweit sind konservierte Körper an eine zukünftige Umwelt anpassbar? Wer wird Zugang zu diesen Verfahren haben?
These 4: Klassenfahrt in die Zukunft
Schon heute gibt es Unterschiede bei der Lebenserwartung (Haan et al. 2017). „Wohlhabendere Menschen leben länger“ titelte die Tagesschau (02. 05. 2024). In Österreich sterben Mindestpensionist:innen früher, und viele Menschen gehen aus prekären Jobs krank in die Pension (Achleitner 2023).
Die technologischen Innovationen für eine Verlängerung des Lebens berücksichtigen kaum die Übertragbarkeit auf die gesamte Gesellschaft. Angesichts der Klimakrise sind deren hohe Kosten für Forschung, Produktion und Energieverbrauch kaum vertretbar. Letztlich bleibt es eine kleine privilegierte Minderheit, die dieses Projekt vorantreibt – auf Kosten der Allgemeinheit. Das unausgesprochene Motto lautet: „Rette sich, wer kann! Also, sofern du es dir leisten kannst.“
Und leisten können es sich die Wenigsten. Die Zeit nach der Pandemie war stark durch die hohe Inflation der letzten Jahre geprägt, und Menschen in finanziellen Notlagen fehlen die Kapazitäten, über das Monatsende hinaus zu planen. Die langfristige Zukunft tritt dadurch in den Hintergrund. Zukunftsgestaltung wird zu einem Privileg, das eng mit Macht, Ressourcen und zeitlichen Möglichkeiten verknüpft ist (Adam 2013; Ryder 2024). So ist auch die Zeit für Engagement und demokratische Partizipation oft nur spezifischen Gruppen vorbehalten, wie Hanna Völkle in ihrem Beitrag im Zeitpolitischen Magazin (Ausgabe 21, Nr. 45, S. 33–36) herausarbeitet.
Kritische Fragen an eine Lebensverlängerung als gesellschaftliches Projekt
Die vorangegangenen Thesen einer Lebensverlängerung als individualistisch-libertärem, umweltschädigenden, technologisierten und elitären Lebensstil beleuchteten deren Auswirkungen auf multiple Krisen. Ob und wie eine Lebensverlängerung als gesellschaftliches Projekt gedacht werden kann, sollen nun die abschließenden Bedingungen aufzeigen: Für eine Lebensverlängerung als gesellschaftliches Projekt müssten Sozial- und Klimapolitik zusammen gedacht werden. Im Mittelpunkt stünden elementare Maßnahmen wie 1. eine bedingungslose öffentliche Daseinsvorsorge zur Stärkung sozialer Infrastrukturen (Gough 2021), 2. die Verankerung von intersektionaler Zeitgerechtigkeit auf räumlicher und globaler Ebene (Dengler et al. 2024), 3. die Dekolonisierung in Denkweisen und Warenströmen (Sultana 2024), 4. die Festlegung von Konsum- und Produktionskorridoren (Bärnthaler & Gough 2023) und 5. müsste ein radikal neues emanzipatorisches Projekt mit Fokus auf verträgliche
Lebensweisen initiiert werden – auch zur Abwendung eines „autocratic-authoritarian turn“ (Blühdorn 2022). Diese Überlegungen bieten erste Ausgangspunkte, um gemeinsam weitere Wege zu finden, eine individuelle
Lebensverlängerung zu überwinden und eine gesellschaftliche Lebensverlängerung im Sinne einer kollektiven Freiheit zu ergründen.
Literatur
Achleitner, S. (2023): Pensionsreport: Ungleichheiten im System. https://www.momentum-institut.at/news/pensionsreport-ungleichheiten-im-system/
Adam, B. (2013): Sustainability through a Temporal Lens: Time, Future, Process. In Netzwerk Vorsorgendes Wirtschaften (Hg.), Wege Vorsorgenden Wirtschaftens (115–130). Metropolis.
Bärnthaler, R. / Gough, I. (2023): Provisioning for sufficiency: envisaging production corridors. Sustainability: Science, Practice and Policy, 19(1), 1–17.
Blühdorn, I. (2022): Liberation and limitation: Emancipatory politics, socio-ecological transformation and the grammar of the autocratic-authoritarian turn. European Journal of Social Theory, 25(1), 26–52.
Chancel, L. / Mohren, C. / Bothe, P. / Semieniuk, S. (2025): Climate change and the global distribution of wealth. Nature Climate Change 15, 364–374.
Dengler, C. / Dornis, N. / Heck, L. / Völkle, H. (2024): Klimafreundliche und gesundheitsfördernde Aspekte von Zeitwohlstand. Gesundheit Österreich (Hg.), Policy Brief. https://jasmin.goeg.at/id/eprint/3423/
Gough, I. (2019): Universal Basic Services: A Theoretical and Moral Framework. The Political Quarterly, 90(3), 534–542.
Haan, P. / Kemptner, D. / Lüthen, H. (2017): The Rising Longevity Gap by Lifetime Earnings – Distributional Implications for the Pension System. DIW Discussion Paper 1698.
Mau, S. (2018): Das metrische Wir: Über die Quantifizierung des Sozialen. Suhrkamp.
Möck, L. A. / Loh, J. (2023): Optimierte Körperbilder – Die Bedeutung von Human Enhancement im Transhumanismus und im technologischen Posthumanismus. In: Zichy, M. (Hg.) Handbuch Menschenbilder (659–687). Springer VS.
Rinderspacher, J. P. (Hg.) (2002): Zeitwohlstand. Ein Konzept für einen anderen Wohlstand der Nation. Ed. Sigma.
Ryder, S. / Kojola, E. / Pellow, D. (2024): Power & Temporality in Pursuing Transformative Planetary Justice. Environmental Politics, 33(7), 1245–1264.
Sultana, F. (Hg.). (2024): Confronting climate coloniality: Decolonizing pathways for climate justice. Taylor & Francis.
Lukas Heck, M.Sc.,
Doktorand an der Wirtschaftsuniversität Wien