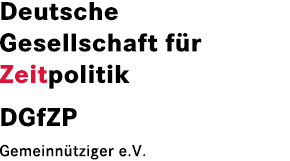Prof. Dr. Cornelia Klinger
Endlichkeit in Zeiten und Räumen
Mein derzeitiges Lebensthema ist die Endlichkeit von allem, was da ist. Dabei geht es, wie beim va banque-Spiel im Kasino, um Alles oder Nichts unter den Bedingungen von
- Zeit und
- Raum sowie
- in den gesellschaftlichen Beziehungen von Lebewesen in der Bandbreite zwischen
- zarten Bindungen und
- harten Fesseln.
Diese drei Dimensionen des Daseins verweisen auf den dreifachen Wortsinn von αρχή (archē).
- Anfang, Beginn, Herrschaft
- Regierung, Herrschaft, Kommando, Amt
- Reich, Gebiet, Statthalterschaft, Provinz
Damit deutet sich bereits am Anfang des Beitrags an, dass Endlichkeit um Themen von Macht, Herrschaft und Gewalt kreist.
Vorab ist festzuhalten, dass das Leben genauso zwei Enden hat wie jede hierzulande übliche Wurst. Der anfängliche Zipfel sieht möglicherweise frisch und hell aus wie der Morgen und kann duften. Der andere Zipfel am Lebens-Abend erscheint notwendigerweise dunkel wie die Nacht und muss stinken. – Aber es hilft nichts: Genau wie bei Lebensmitteln gehören Werden und Vergehen auch bei Lebewesen zusammen. Damit nicht genug, liegen zwischen den Polen von Geburt (Natalität) und Tod (Mortalität) viele Übergänge. Um nur einige signifikante en passant zu erwähnen:
- Im Auf und Ab zwischen Kindheit/Jugend und dem Erwachsenenalter/Greisenalter betreffen Übergänge das Dasein ‚am eigenen Leib‘;
- in Kopulation/Kohabitation finden Übergänge zwischen verschiedengeschlechtlichen und anderen fremdartigen Lebewesen statt;
- und dann ist da noch der Zwiespalt zwischen Sterben-Müssen und Töten-Können.
Die notwendigen Trans-Formationen zwischen eigenen Lebensweisen in unterschiedlichen Lebensphasen und allen möglichen Trans-Aktionen mit anderen Lebewesen sind allesamt heikel; sie variieren, oszillieren allemal zwischen ersehnten Überschreitungen (lustvollen Exzessen), zulässigen Übertritten, verbotenen Übertretungen, friedlichen Überführungen und gewal(tät)igen Übergriffen. Das Da-Sein spielt sich ab im clair-obscur zwischen Angst-Lust und Leid-Freud, im Vor- und Zurück von Angriff vs. Abwehr, Hoffen und Bangen.
Wer bis zu dieser Stelle gelesen hat, wird es der Autorin nachsehen, dass sie im Weiteren versuchen wird, das prekäre Terrain von Dasein zwischen Da oder Fort, Sein-oder-Nicht-Sein beziehungsweise von So-oder-Anders-Sein zu verlassen, um von solch schwankenden Brettern auf den festen Boden des Wissens zu gelangen.
*
Beim Thema Wissen treffe ich im Voraus eine mutige, aber fahrlässig grobe Unterscheidung zwischen Sinn-Wissen und Funktions-Wissen.
Sinnwissen fragt viel nach:
Woher und Wohin?
Warum/Weshalb und Wozu?
Wer oder Was?
1) Zu Lebzeiten müssen Lebewesen in ihren Lebensräumen „bei Sinnen“ sein, um sich zu orientieren in dem überbordenden Durcheinander oder in der wüsten Leere, die sie jederzeit und überall umgeben. Sie müssen sich nach heller/dunkler, drunter/drüber, hinten/vorn, vorher/nachher, links/rechts, innen/außen, näher/weiter umtun und sich danach (aus)richten.
2) Zu allem Überfluss stellen sich scharfsinnigen, weitsichtigen, hellhörigen, feinfühligen Lebewesen Fragen, die sowohl über ihre begrenzten alltäglichen Notwendigkeiten als auch über die Möglichkeiten ihrer schwachen Sinne hinausgehen: Manche be-sinnen sich auf weitergehende Fragen und begeben sich auf die Suche nach
- Ursprung vor jedem Beginn(en): αρχή (archē)
- Ziel/Zweck nach dem Ende(n) der Endlichkeit: τέλος (télos)
- das Gute an und für sich, das summum bonum: καλοκαγαθία (kalokagathía)
Solche Sinnsuchenden fragen nach dem, das zwar hier und jetzt nicht da ist, aber irgendwo früher mal da war oder irgendwann später dort werden wird. Ihnen geht es um das, was sie sich als bleibende Sub-stanz oder als Sub-jekt ὑποκείμενον/‚hypokeímenon) vorstellen.
3) Auf Anhieb ist einzusehen, dass „Mängelwesen“ beide Aspekte von Sinnwissen für notwendig erachten, um die Not zu wenden, um die Nöte des in den Grenzen seiner Endlichkeit dürftigen Lebens zu befriedigen. Und da sind auch immaterielle Bedürfnisse zu bedenken. In allen Hinsichten gilt es, Bedarfe zu decken, die Leere zu füllen: Das Notwendige betrifft die Notdurft des Leibes ebenso wie die Nöte der darin wohnenden Seele. Kurzum, zum Sinnwissen gehören Sinn und Sinnlichkeit (sense and sensibility). Und dem Sinnwissen obliegt es, die divergierenden Wege seiner beiden ungleichen Teile sinnvoll zu verbinden.
4) Dabei zeigt es sich, dass Sinnwissen eine narrative
Kulturtechnik ist, die mit Worten und Bildern, Metaphern und Allegorien arbeitet. Ob die großen Erzählungen wie Sagen, Mythen oder Legenden von kleinen Märchen abstammen, ob die Erzähltechnik des Sinnwissens später vielleicht nur noch in Gute-Nacht-Geschichten Platz findet, welche
- einerseits von Anfängen berichten: „Es war einmal…“ in unbestimmter grauer Vorzeit und
- andererseits am märchentypischen Schluss „…so leben sie noch heute“ ein glückliches Finale in Aussicht stellen.
5) Solch „loses“ Sinnwissen, wie es Menschenkinder beim Einschlafen gern glauben wollen und davon träumen, kondensiert sich bei ernsthaften Sinnsuchern zu festem Glauben. Also reimen sich Glaubensregime auf das wortbasierte, narrative Sinnwissen; dieses braut sich zu Religion(en) zusammen. In weiterer Folge transfigurieren sich die in zeitlicher Hinsicht nebulösen Anfänge und die räumlich indefiniten Enden in ein als Über-Oben vorgestelltes Jenseits, das Gelehrte in diesem Kulturraum vor langer Zeit Transzendenz getauft haben.
Auf diese Weise wird dem irdischen Dasein ein höherer, ja höchster, übersinnlicher Sinn verliehen, ein Wissen, das den schwergewichtigen Namen Wahrheit tragen soll und die Sinnfälligkeit des alltäglichen, sinnlichen Wissen zugleich beansprucht und übersteig(er)t.
Funktionswissen fragt nicht so viel, sondern einfach nur:
Wie/How?
Wie geht es Dir/How do you do?
Wie geht denn das/How to?
Die Knowhow-Fragen kreisen samt und sonders
- um das Tun im Handel(n) von und mit Lebewesen nebst Lebensmitteln und
- um das Machen im Herstellen und Produzieren von ‚toten‘ Dingen, Sachen als gegenständlichen Gütern, die Menschen gehören, also Zubehör sind.
- Knowhow kombiniert Da-Sein mit Dabei-Haben: Das Dasein von Lebewesen als menschlichen Subjekten ist angewiesen auf das Vorrätig- und Parathalten von Mitteln als Objekten. In der Subjekt-Objekt-Relation ist Funktionswissen unpersönlich, neutral gegenüber beliebigem Sinn und allen möglichen Zwecken; es verfährt in Verfahren analytisch, zergliedernd, zerlegend, auflösend, schließlich soll Funktionswissen ja zu realen Lösungen führen. – Das erst neuerdings in Gebrauch genommene, in deutscher Sprache so genannte Handy könnte als Inbegriff dieser Art des Zur-Hand-Habens gelten.
Dem Common Sense dürfte verständlich sein, dass Lebewesen (zumal menschliche) überall und jederzeit sowohl sinnlich-sinnvolles Wissen von Ziel und Zweck gut brauchen können, als auch Kenntnisse von Mitteln sowie Instrumenten, die sie gebrauchen müssen, um in kürzerer Zeit von A nach einem zunehmend weiter entfernten B zu gelangen. – Aber bereits bei meinen Erläuterungen zum Sinnwissen hat sich gezeigt, dass das Verhältnis von Sinn- und Funktionswissen nicht so raum- und zeitlos ist, wie es dem Common Sense nach sein sollte.
1) In der Wendezeit vom abendländischen Mittelalter zur westlichen Neuzeit entwickelt sich aus dem Transzendenz-Verlust des Sinnwissens auf der planen Fläche der Immanenz eine Art von Funktionswissen, das Transparenz in Aussicht stellt:
- In räumlicher Hinsicht wird der Blick frei und wandert auf einen zentralperspektivisch geöffneten, endlos offenen Horizont zu. Die Idee von Ewigkeit in statisch-ständischer Ordnung wird beweglich.
- In der Zeitorientierung tritt ein Strömungswechsel ein, a sea change: weg von einer autoritativ-autoritären Vergangenheit im Sinne von Ursprung, Herkunft und Überlieferung läuft der Zeitfluss höher, schneller, weiter auf eine offene Zukunft hin.
Mit Worten von Michel Foucault ließe sich der Unterschied zwischen altem Sinn- und neuem Funktionswissen so bezeichnen: Die alten Glaubensregime bieten l’explication par le haut, von über-oben durch Offenbarung herab; dagegen offeriert das neuartige Funktionswissen seit dem Säkularisierungs- und im weiteren Modernisierungsprozess l’explication par le bas. Im Vergleich zum strengen alten Regime erscheint das Neue neugierig, fortschrittlich und freiheitlich. Vor allem eröffnet es Aussicht auf Erfolg in der Realitätsbewältigung durch rationale und fortschreitend rationalisierte, effektive, punktgenaue Lösungen für kleinteilige Probleme. Das Knowhow ist flexibel und fallibel. Alles, was da ist, wird durch neue Entdeckungen und Erfindungen in Frage gestellt – die Revolution in Permanenz ist das Prinzip des Fortschritts im Funktionswissen. Das unbestimmt bleibende Ende der Expeditionen ins Neuland liegt in einer zwar unendlich fernen, aber nicht nebulösen Zukunft.
2) Solch grundstürzende Veränderungen gehen mit einem Wechsel der leitenden Kulturtechnik einher: Vom Wort zur Zahl.
Die Buchstabenkette des Alphabets, die bei A (ἄλφα/álpha) ihren Anfang nimmt und bei O (ὠ μέγα/ō méga) sich vollendet, liegt dem geschlossenen Regime des wortbasierten Sinnwissens zugrunde. Die Ironie der Geschichte: Das geschlossene Alphabet lässt sich unendlich kombinieren, in tausend Zungen bereden; die nieder-geschriebenen, fixierten heiligen Worte, das Gesetz des Einen und Höchsten … sie werden unterschiedlich gelesen; sie lassen vielfältig variierte, vielschichtig nuancierte, kurzum weit auseinander gehende Interpretationen zu.
Das dürfte dazu geführt haben, dass das frühmoderne mono-theistische Motto sola scriptura bereits ein Jahrhundert später durch nullius in verba abgelöst wird – vielleicht nicht zufällig, nachdem die strittigen Auslegungen der Schrift in blutigen Religionskriegen europaweit heillose Zerstörungen angerichtet haben. Um die Null herum ist der Transit vom Wort zur Zahl besiegelt. Nach Maßgabe der neu entwickelten infinitesimalen Rechnung, die immer weiter zählen kann, sind beliebig viele Zahlen da: Kohlköpfe lassen sich genauso anonym-sachlich-neutral zählen wie Menschenschuhe.
3) Anders als das wortbasierte Sinnwissen, welches in Glaubensregimen Platz nimmt, konzentriert sich das neuartige Funktionswissen in den modernen Wissenschaften, die von der zahlenbasierten Mathematik angeführt werden. Eigentlich ist Mathematik uralt; seit jeher musste gerechnet und berechnet werden. Seit dem Anbruch der Neuzeit verändern sich Struktur und Stellung dieser Wissensgestalt zur mathesis unversalis.
4) An die Stelle der fanatischen Suche des alten Sinnwissens nach einer Wahrheit im Jenseits tritt beim modernen Funktionswissen das systemisch-systematische Streben nach Gewissheit des Weges. Wenn der Weg selbst zum Ziel, zum Selbst-Zweck erklärt wird, muss die Straße gesichert sein, die immer rasanter werdende Fahrt auf Schritt und Tritt kontrolliert werden.
Der Progress in die Zukunft, der mit dem Projekt der Aufklärung begonnen hat, wird zu einem endlosen Prozess nach Maßgabe von Verfahren. Das auf Effizienz, Effekte und Effektivität angelegte Funktionswissen lässt die Vergangenheit achtlos hinter sich, es überholt und unterhöhlt die Gegenwart. Und doch scheint die Zukunft nur in exakter Pfadabhängigkeit von der Gegenwart designt zu werden: more of the same.
*
Was bedeutet das am Ende in Hinblick auf mein Lebensthema Endlichkeit?
Bei aller Würdigung der Glaubensregime in ihrem Streben nach Wahrheit und trotz der Anerkennung gewisser Sicherheiten, die das Wissenschaftssystem herstellt („science works!“), scheint mir (mehr als methodisch-cartesianischer) Zweifel angebracht. Beide Wissensweisen und Wissenswege haben zwar etwas anzubieten: Religion macht mehr Hoffnung, der feste Glaube verheißt Leitung, Halt(ung) und spendet Trost – Wissenschaft verspricht Leistung, schafft Rat und Tat. Indes bleiben die Erwartungen auf das Heil im Glauben zwischen den diversesten und divergierenden Lehren umstritten plural, – die Hoffnungen auf Heilung durch Wissenschaft erweisen sich als partikular. Das Ergebnis lässt sich so zusammenfassen: „Modernity has accomplished many far-reaching transformations, but it has not fundamentally changed the finitude“ (Berger/Berger/Kellner 1973).
Prof. Dr. Cornelia Klinger, Privatgelehrte und ausserplanmässige Professorin für Philosophie
an der Eberhard Karls-Universität Tübingen. Schwerpunkte im Bereich der Politischen Philosophie
(Achsen der Ungleichheit), in der Ästhetik (zur Romantik und zur Geschichte des Schönen und Erhabenen), Theoriegeschichte und Geschichtstheorie der Moderne, Gender Studies im Bereich Philosophie
(Theorie und Geschichte des Patriarchats).