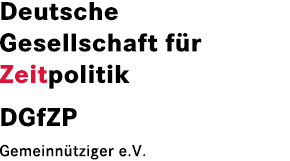Dietrich Henckel
Zeitlichkeiten am Lebensende
Zeitpolitische Überlegungen und Folgerungen
Einführung
Die Tagung „Zeitlichkeiten am Lebensende“ hat gezeigt, dass zahlreiche Herausforderungen, die von Professionellen in Hinblick auf den Umgang mit Sterbenden in ihren Arbeitsfeldern beschrieben werden, sich nicht selten als zeitliche Gestaltungsaufgaben interpretieren lassen. Wir hatten bei der Vorbereitung der Tagung die Vortragenden ausdrücklich gebeten, zu versuchen, ihr jeweiliges Arbeitsfeld und ihre Expertise explizit unter Zeitaspekten darzustellen. Die verschiedenen Vorträge, die in diesem Heft dokumentiert sind, lassen erkennen, wie vielfältig die zeitlichen Dimensionen im Zusammenhang von Sterben, Versorgung, Tod und Trauer sind (auch wenn in dieser Tagung nur Ausschnitte behandelt werden konnten) und wie hilfreich es sein kann, Situationen, Probleme, Konflikte im eigenen Tun unter Zeitperspektiven zu betrachten.
Die Tagung hat zudem wieder einmal eindrücklich eine Tatsache vor Augen geführt: Auch wenn es eine Binsenweisheit ist, dass alles in Raum und Zeit stattfindet, machen die meisten Personen sich in ihrem eigenen Betätigungsfeld selten die zeitlichen/zeitpolitischen Dimensionen ihres Fachgebiets, ihrer Profession bewusst. Vor diesem Hintergrund ist es eine der Aufgabenstellungen der DGfZP, für die zeitlichen Dimensionen in allen Lebensbereichen zu sensibilisieren und die gesellschaftlichen Gestaltungsmöglichkeiten, die mit Zeitlichkeiten, verbunden sind, zu eruieren. Dies auch, wenn sie selten im expliziten Sinn als solche verstanden werden. Diese Aufgabenstellung scheint unsere Veranstaltung in der Evangelischen Hochschule in Darmstadt einmal mehr erfüllt zu haben.
Der folgende Text versucht, eine grobe systematische Zusammenschau zeitlicher Dimensionen und zeitlicher Konflikte zu geben, wie sie aus den Beiträgen der Referentinnen und Referenten sichtbar wurden, um daraus erste zeitpolitische Schlussfolgerungen zu ziehen.
Zeitliche und zeitpolitisch relevante Sachverhalte
Die Tagung hat nur einen Teil der Zeitlichkeiten, die mit Sterben, Tod, Trauer und allem, was damit zusammenhängt, zum Thema machen können. Sehr grob zusammengefasst kann man feststellen, dass es um eine fast unübersehbare Vielzahl von Normen, also Gesetzen, Verordnungen, Vereinbarungen und Konventionen geht, die die „geregelten“ Zeitlichkeiten bestimmen. Dies sei an einigen Beispielen kurz erläutert.
Gesetze regeln,
- welche zeitliche Unterstützung Pflegebedürftige (je nach Pflegegrad) in Anspruch nehmen können, wie lange Behandlungen dauern dürfen, wie sie entgolten werden.
- wie mit Gestorbenen umgegangen werden muss oder darf, wie lange aufgebahrt werden kann, welche Fristen etwa bis zur Beerdigung eingehalten werden müssen, wie lange Gräber genutzt werden können.
- welche Zeiträume Hinterbliebenen zugebilligt werden von der Fortzahlung der Einkünfte der Verstorbenen, der Dauer von Witwen- und Waisenrenten über die zugebilligten Trauerzeiten (u. a. freie Tage nach dem Tod eines Angehörigen) bis hin zur Dauer von Urheberrechten, die den Erbinnen und Erben der verstorbenen Person zugestanden werden.
Konventionen sehen u. a. vor
- wie Trauerperioden gestaltet werden sollen, wie lange sie dauern dürfen (eine über die in einem Kulturkreis übliche Trauerzeit hinausgehende Trauer ist mittlerweile als psychische Störung klassifiziert).
- welche zeitlichen Rituale für Zugehörige, Freunde und Bekannte erwartet werden oder üblich sind.
Ökonomische Rahmenbedingungen haben u. a. Einfluss darauf
- welche Zeiten in der medizinischen/pflegerischen Betreuung aufgrund der Honorarordnungen und damit verbundener Anreize zur Verfügung stehen.
- wie lange eine Beisetzung dauern darf, weil hierdurch die in der Regel engen Abfolgen von Beerdigungen auf den Friedhöfen getaktet werden.
Phasenmodelle des Sterbens sollen nicht nur analytisch beschreibend den Ablauf des Sterbens erfassen helfen, sondern gleichzeitig auch Hilfestellung für das Verhalten vor allem der begleitenden Personen in den unterschiedlichen Phasen liefern.
Definition des Todes: Selbst die medizinisch/juristisch nicht unumstrittene Festlegung des Hirntodes als Todeszeitpunkt hat im Zusammenhang mit Organtransplantationen zeitliche Folgen, weil nach Feststellung des Hirntods Vitalfunktionen aufrechterhalten werden müssen, um Organe für Transplantationen entnehmen zu können, d. h. der Tod muss so spät wie möglich, aber so früh wie nötig festgestellt werden.
Selbst bei dieser schmalen und selektiven Andeutung zeitlicher Dimensionen ist offenkundig, wie sehr diese Regelungen und Erwartungen an soziale und kulturelle Kontexte gebunden sind, wie stark sie sich also in Hinblick auf Regionen, historische Perioden, Religionen, Klassen und andere soziale Gruppierungen unterscheiden – wichtige Aspekte, die in der Tagung leider nicht ausführlicher behandelt werden konnten.
Sehr viel uneindeutiger, volatiler und weniger bestimmbar verhält es sich mit subjektiven/persönlichen Zeiten, also allem, was mit individueller Zeitwahrnehmung und daraus resultierendem Verhalten verbunden ist: Dabei geht es um die Zeiten der Zuwendung, der Einkehr, des Rückzugs, der Selbstsorge sowohl für die sterbende Person als auch für die begleitenden Personen (Professionelle, Zugehörige). Solche Zeiten sind von Normen nur eingeschränkt erfassbar, weil sich einerseits die Zeitwahrnehmung in unterschiedlichen Phasen des Sterbens und bei der Begleitung für alle Beteiligten immer wieder stark verändert und andererseits die zeitliche Flexibilität der Beteiligten sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Auch das hängt damit zusammen, dass die Konventionen und Ritualisierungen an Prägekraft verloren haben, Sterben und Tod weniger sozial eingebunden und zur „Privatsache“ geworden sind und durch Medikalisierung immer stärker in ein professionelles Umfeld eingebunden wurden.
In den Beiträgen von Gockel und Schieweck (in diesem Heft) werden aus der jeweiligen professionellen Perspektive die Zeitlichkeiten noch einmal sehr spezifisch kategorisiert. Matthias Gockel sieht aus Sicht der Palliativmedizin die einzelfallabhängige Zeit, die für die Aufklärung des Patienten benötigt wird und bei der es auch um die Aufklärung über die voraussichtlich noch verbleibende Zeit geht, als zentral an. Denn daraus ergeben sich zeitliche Rahmenbedingungen für die Klärung offener Fragen und für gemeinsames „Sein“ sowie für Abschied und gemeinsame Trauer.
Alles bisher Gesagte und der Großteil der Beiträge auf der Tagung beziehen sich im Wesentlichen auf das Lebensende nach Krankheit und/oder hohem Lebensalter – sie machen statistisch die überwiegende Zahl der Sterbefälle aus. Denn mehr als die Hälfte aller Sterbefälle finden im Krankenhaus statt, weitere rund 30 % in anderen Einrichtungen (Pflegeheim, Palliativstation und Hospiz) und nur etwas über 20 % im häuslichen Umfeld. Anders sieht es beim plötzlichen Tod durch Infarkte, Unfall, Katastrophen, Verbrechen, Krieg o. ä. aus. Hier entfallen wesentliche „begleitende“ Zeiten von Zugehörigen und Professionellen. Der plötzliche Tod, der keine Verabschiedung von Angehörigen erlaubt, erzeugt zeitlich ganz andere Problemlagen, die Werner Schieweck aus der Sicht der Notfallseelsorge unter den Kategorien des Erlebens (Zeuge des plötzlichen Todes einer Person sein), des Mitteilens (die Nachricht eines plötzlichen Todes überbringen müssen), des selbst Zufügens (den Tod eines anderen in einer Notsituation als Polizist verursachen) und des Erleidens (selbst erleben) erläuterte. Es wurde deutlich, dass die spezifische zeitliche Situation in diesen Fällen auch eine besondere Begleitung erfordert.
Zeitkonflikte
All diese unterschiedlichen Beschreibungen lassen eine Vielzahl von Zeitkonflikten aufscheinen:
- Ungleichzeitigen zwischen Sterbenden und Zugehörigen bezogen auf zeitliche Erwartungen der sterbenden Person an die begleitenden zugehörigen und professionellen Personen, die sich stoßen an den zeitlichen Möglichkeiten der Zugehörigen (die beschränkt werden durch persönliche Bedingungen sowie durch soziale Verpflichtungen – Erwerbsarbeit, Sorge u. a.) und Restriktionen, die für Professionelle durch ihre Einbindung in ihre jeweilige Institution und die dadurch bedingten Anforderungen und Anreizsysteme gegeben sind.
- Zeitkonflikte der Professionellen durch personelle Unterausstattung sowie durch Berichtspflichten, ständige Priorisierungsentscheidungen zwischen Patienten und für notwendig erachtete Betreuung auf der einen Seite und bezahlte Leistung andererseits. (Die Finanzierung der Versorgung wirkt vielfach als Grundlage von Zeitkonflikten, etwa weil apparative Leistungen eher abzurechnen sind als erweiterte zeitliche Betreuung.)
- Gerade bei der Notwendigkeit, über längere Zeitabschnitte Sorgezeiten für Zugehörige einplanen und bereitstellen zu wollen oder zu müssen, treten häufig erhebliche Konflikte mit beruflichen Verpflichtungen, Sorgezeiten für kleine Kinder oder anderen sozialen Aufgaben auf.
- Konflikte treten auch auf durch unterschiedliche Zeitwahrnehmungen von Betroffenen, Pflegenden und Zugehörigen, was sich etwa in unterschiedlichen Vorstellungen über den Zeitpunkt des nahenden Endes und in resultierendem Verhalten manifestieren kann.
- Konflikte zwischen individuellen Bedürfnissen und gesellschaftlichen Regeln, die besonders bei der Trauer deutlich werden. Einerseits gilt ein Trauerjahr als eine Art gesellschaftlich akzeptierte Dauer, gleichzeitig ist der Inhalt völlig unbestimmt und in beruflichen Zusammenhängen wird üblicherweise ein sehr schnelles „Funktionieren“ selbstverständlich vorausgesetzt. Das ist auch eine Folge der „Privatisierung“ des Todes. Die noch in den 1960er Jahren übliche Trauerkleidung oder der Trauerflor sind aus dem Alltag fast vollständig verschwunden.
- Ein Zeitkonflikt ist auch die oben angesprochene Feststellung des Todeszeitpunkts, wenn die sterbende
- Person einen Organspendeausweis hat und daher die Aufrechterhaltung von Vitalfunktionen für die rechtzeitige Organentnahme von Bedeutung ist.
- Eine „Neuordnung“ der Zeit ist besonders im Falle des plötzlichen Todes einer nahestehenden Person erforderlich, der den „erwarteten Zukunftshorizont“ zerbricht.
- „Nicht dem Leben mehr Tage, sondern den Tagen mehr Leben geben“ (Cicely Saunders) als Motto der Hospizbewegung ist eine normative Auflösung eines Grundkonflikts, der vor allem durch medizinischen Fortschritt an Brisanz gewinnt: der Konflikt zwischen den verschiedenen Methoden der Verlängerung des
- Lebens (Stichworte: Prävention, Selbstoptimierung, longevity, lifespan vs. healthspan, Kryonik etc. mit allen Nebenwirkungen) und einem dezidierten Carpe Diem (Stichworte: Feiern des Augenblicks, Lebenskunst, Akzeptanz des Unvermeidlichen, der Unvorhersehbarkeit, der Unergründlichkeit).
- Konflikte treten auf zwischen „Sterbenlassen und Gestorbenwerden“, wie M. Gronemeyer (2005) es nennt. Damit wird der Konflikt beschrieben, der sich auftut, wenn ein expliziter oder impliziter Druck empfunden wird, „freiwillig“ aus dem Leben zu scheiden.
- Zeitknappheit und Verdrängung werden als „effektives Paar“ beschrieben, weil der zeitliche Druck dazu verleitet, die Auseinandersetzung mit den Veränderungen, die mit dem eigenen Lebensende oder dem eines Zugehörigen zwangsläufig verbunden sind, zu verschieben.
Eine umfassende Studie über die Zeitlichkeiten am Lebensende müsste all diese und viele weitere Facetten systematisch und detailliert in den Blick nehmen. Das konnte von einer explorativen Tagung nicht erwartet werden. Vor dem Hintergrund, wie viele zeitliche Aspekte und vor allem implizit und explizit zeitliche Regelungen für das Lebensende eine Rolle spielen, und bedingt durch den Anspruch, auch für die letzte Lebensphase eine den normativen Forderungen angemessene zeitliche Rahmung zu geben, die zeitliche Selbstbestimmung gewährleistet, ist es notwendig, sich mit den zeitpolitischen Implikationen vertieft auseinander zu setzen.
Zeitpolitische Forderungen
Die normativen Grundlagen, auf die sich zeitpolitische Überlegungen beziehen müssen, gehen letztlich auf die Formulierung des Rechts auf Zeit zurück und stellen folgende Punkte in den Mittelpunkt
- zeitliche Autonomie/zeitliche Selbstbestimmung, was die Sicherung von selbstbestimmter zeitlicher Flexibilität enthält,
- Recht auf gemeinsame Zeiten,
- Verbesserung der Lebensqualität durch Erhöhung der zeitlichen Selbstbestimmung.
Eine grundlegende Forderung ist, dass in allen Belangen die zeitlichen Dimensionen und Implikationen explizit in den Blick genommen werden müssen, um die Wirkungen auf zeitliche Selbstbestimmung, gemeinsame Zeiten, quantitativ genügend disponible Zeiten zu beurteilen und ggf. Maßnahmen ableiten zu können. Dies gilt es dann in einzelnen Bereichen zu konkretisieren und auszuformulieren. Eine Wende zur Stärkung der zeitlichen Autonomie des Individuums war das Bundesverfassungsgerichtsurteil von 2020 zum selbstbestimmten Sterben. Die nunmehr durch das Verfassungsgericht zugestandene Selbstbestimmung über das eigene Sterben, das Recht, den eigenen Todeszeitpunkt selbstbestimmt festlegen zu dürfen, ist ein sehr weitreichender Schritt im deutschen Recht, um zeitliche Autonomie in einer der existenziellen (zeitlichen) Fragen zu gewährleisten.
Weitere Stichpunkte zu zeitpolitischen Forderungen für einen humanen Umgang mit Sterben und Tod sind:
- Wesentliche Bestandteile des Rechts auf Zeit – zeitliche Selbstbestimmung, zeitliche Autonomie und vor allem gemeinsame Zeiten – sind von besonderer Bedeutung auch und gerade am Lebensende für die sterbende Person und für die begleitenden Personen. Eine Kernbedingung dafür ist, möglichst flexible zeitliche Arrangements unter schwierigen Rahmenbedingungen für alle Beteiligten zu ermöglichen.
- Medizinische Einrichtungen, Krankenhäuser vor allem, sind Orte, die durch enge zeitliche Taktungen und in der Regel Hektik gekennzeichnet sind. Für Sterbende und ihre Begleitung geht es darum, Zeiten in Ruhe mit wichtigen Menschen in einem unruhigen System sicherzustellen. Palliativstationen sind in dieser Hinsicht ein wesentlicher Fortschritt. Aber solche Möglichkeiten müssen weiter ausgebaut werden.
- Die Zeiten für Trauer sollten ebenfalls flexibler geregelt werden. Denkbar wäre u. U. eine Einbeziehung von (individuell definierten) Trauerzeiten in das Optionszeitenmodell – vgl. Jurczyk, Mückenberger 2020).
- Es ist eine offene Debatte über die Trade-offs zwischen Technik und Zeit (Zeiten des ärztlichen Gesprächs können Einsatz von Technik und medizinischen Maßnahmen und damit Ressourcen sparen), zwischen Zeiten der Behandlung und der Dokumentation erforderlich, um der „Entwertung“ von Zeit entgegenzuwirken. In diesem Zusammenhang spielen Reformen von Vergütungssystemen und ihren Anreizwirkungen, wie sie immer wieder gefordert werden, gerade in zeitlicher Hinsicht eine zentrale Rolle. (Einen ersten Schritt und Erfolg kann man in der Veränderung des Finanzierungssystems im Krankenhauswesen in der letzten Legislaturperiode sehen, durch die teilweise Ersetzung der Fall- durch Vorhaltepauschalen).
Nur eine systematische Auseinandersetzung mit Zeitkonflikten und ihren Ursachen erlaubt die gezielte Suche nach Lösungsmöglichkeiten.
Fazit
Zeitpolitiken sind Machtpolitiken. Die Verfügbarkeit von Zeit, die Rechte an Zeit sagen etwas darüber aus, wie ernst eine Gesellschaft ein Anliegen nimmt.
Trotz einer Vielzahl relevanter Einzelforderungen, die auch aus anderer Perspektive vor allem von medizinischen und pflegerischen Akteuren immer wieder gestellt wurden und werden, sind übergreifende zeitpolitische Forderungen für das Lebensende schwer zu formulieren, weil die Anforderungen aus zwei Gründen sehr widersprüchlich sind:
- Zwar ist klar, dass das Ende eintritt, aber das wann ist (außer man legt Hand an sich) nicht verlässlich bestimmbar.
- Das Lebensende ist in besonderem Maße von individuellen Bedingungen geprägt, weshalb sich nur schwer allgemeine Forderungen ableiten lassen.
Die allgemeinste zeitpolitische Forderung, die sich formulieren lässt, ist der Anspruch auf große zeitliche Flexibilität (Umfang von Zeiten und die Wahl von geeigneten Zeitpunkten) für alle Beteiligten. Da die zeitliche Verfügbarkeit einzelner Personen in komplexen sozialen Zusammenhängen aber immer durch externe Rahmenbedingungen und wechselseitige Abhängigkeiten beschränkt ist, müssen die Möglichkeiten und Bedingungen für eine Inanspruchnahme nötiger Zeitkontingente in den einzelnen Zusammenhängen sehr genau ausgelotet werden.
Was dabei eine Rolle spielt:
Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Akteure professioneller und privater Art, die völlig unterschiedliche zeitliche Anforderungen haben, bei denen völlig unterschiedliche soziale Einbettungen vorliegen.
Alle sterben, aber der Zeitpunkt ist ungewiss, die Umstände, der Verlauf sind ungewiss, so dass Selbstbestimmung für alle Beteiligten ein besonders hohes Maß an Flexibilität voraussetzt, die in einer hochkomplexen und vernetzten Gesellschaft nur eingeschränkt verfügbar ist.
Der Sterbeprozess hat Stufen, aber sie sind in ihrer Dauer nur schwer kalkulierbar. Ebenso wenig ist es der Trauerprozess, der länger oder kürzer dauern und immer wieder unerwartet in neuen Wellen, episodenhaft auftreten kann. Selbst sozial akzeptierte „Normaldauern“ (Trauerjahr), werden von zwei Seiten infrage gestellt: Für das Funktionieren im Alltagsleben und im Beruf wird einerseits in der Regel nur eine sehr kurze Dauer akzeptiert. Andererseits werden längere Dauern pathologisiert und bei Erfüllung bestimmter Kriterien als psychische Störung klassifiziert.
Aus den verschiedenen Beiträgen wurde ersichtlich, dass durch die Individualisierung und kulturelle, aber auch religiöse Ausdifferenzierungen bislang gültige formelle und informelle Regeln und Rituale an Prägekraft und Verbindlichkeit eingebüßt haben. Dadurch sind weitgehende allgemeine Normen immer schwerer aufrechtzuerhalten. Auch am Lebensende erfolgt eine Ausdifferenzierung und Individualisierung von Verhaltensformen.
Daher sind künftig weitere Ausdifferenzierungen der Zeitlichkeiten und damit einhergehend eine weitere Zunahme der Inkompatibilitäten und der Konflikte zu erwarten. Solche Konflikte werden sich nur dann lindern lassen, wenn die Spielräume für Flexibilität erweitert werden.
Literatur
Gronemeyer, Marianne (2005): Sterbeorte. Vortrag auf der Tagung „Das Sterben in die Mitte holen“, 11. November 2005 in Köln. https://www.imew.de/de/barrierefreie-volltexte-1/volltexte/sterbeorte Zugriff 01.02.2025.
Jurczyk, Karin / Mückenberger, Ulrich (Hrsg.) (2020): Selbstbestimmte Optionszeiten im Erwerbsverlauf. Forschungsprojekt im „Fördernetzwerk Interdisziplinäre Sozialpolitikforschung“ (FIS). München/Bremen. Abschlussbericht https://www.fis-netzwerk.de/fileadmin/fis-netwerk/Optionszeiten_Abschlussbericht_DJIBroschuere_Endg.pdf
Dietrich Henckel
Vorstand DGfZP,
Prof. i. R. Stadt- und Regionalökonomie,
Institut für Stadt- und Regionalplanung TU Berlin
Zeitlichkeiten am Lebensende – Leseliste
Auch wenn immer wieder von der Tabuisierung von Sterben und Tod gesprochen wird, gibt es eine unübersehbare Literatur zum Thema – wissenschaftliche Untersuchungen, Essays, Erfahrungsberichte, Belletristik, vermehrt auch Kinderbücher. Selbstverständlich spielt das Thema in Filmen – Dokumentationen, Spielfilmen –, in Radiosendungen und in Blogs eine wichtige Rolle.
Die folgende Literaturliste ist aus der eigenen Beschäftigung mit dem Thema, der Vorbereitung der Tagung und des vorliegenden Heftes entstanden. Sie ist als Anregung für Personen gedacht, die sich weiter und intensiver mit dem Thema auseinandersetzen möchten. Zwangsläufig ist sie selektiv und subjektiv.
Adichie, Chimamanda Ngozi (2021): Trauer ist das Glück, geliebt zu haben. Frankfurt/M. (S. Fischer).
Améry, Jean (1971): Über das Altern. Revolte und Resignation. Stuttgart (Klett, Versuche 13).
Ardelius, Lars / Jersild, P. C. (1994): Gedanken über den Tod. Frankfurt/M. (Suhrkamp).
Ariés, Philippe (1999): Geschichte des Todes. München (dtv).
Arnim, Gabriele von (2023/2015): Das Leben ist ein vorübergehender Zustand. Reinbek (Rowohlt).
Barnes, Julian (2006/2014): Lebensstufen. München (btb).
Borasio, Gian Domenico (2013): Über das Sterben. Was wir wissen. Was wir tun können. Wie wir uns darauf einstellen. München (C. H. Beck):
Bovenschen (2008): Älter werden. Frankfurt/M, (Fischer).
Caduff, Corina / Afzali, Minou / Müller, Francis / Soom Ammann, Eva (Hrsg.): Kontext Sterben. Institutionen – Strukturen – Beteiligte, Zürich 2022 (Scheidegger & Spiess).
Cicero (1949): Vom Alter, von der Freundschaft und vom höchsten Gut und Übel. Zürich (Rascher).
Coenen, E. (2020): Zeitregime des Bestattens. Thanato-, kultur- und arbeitssoziologische Beobachtungen (Besprechung). In: Benkel und Meitzler (Hrsg.): Jahrbuch für Tod und Gesellschaft 2023, Weinheim Basel, 159-160.
Elias, Norbert (1982): Über die Einsamkeit des Sterbenden. Frankfurt/M. (Suhrkamp).
Eribon, Didier (2024): Eine Arbeiterin. Leben, Alter und Sterben. Berlin (Suhrkamp).
Feldmann, Klaus (2004): Tod und Gesellschaft. Sozialwissenschaftliche Thanatologie im Überblick. Wiesbaden (VS Verlage für Sozialwissenschaften) (2. bearb. Auflage 2010).
Gockel, Mathias (2020): Sterbehilfe. 33 Fragen – 33 Antworten. München (Piper).
Gockel, Matthias (2019): Sterben. Warum wir einen neuen Umgang mit dem Tod brauchen. Berlin/München (Berlin Verlag).
Gronemeyer, Marianne (2005): Sterbeorte. Vortrag auf der Tagung „Das Sterben in die Mitte holen“, 11. November 2005 in Köln. https://www.imew.de/de/barrierefreie-volltexte-1/volltexte/sterbeorte Zugriff 01.02.2025.
Gronemeyer, Marianne (1993/1996): Das Leben als letzte Gelegenheit. Sicherheitsbedürfnisse und Zeitknappheit. Darmstadt (Primus).
Heidenreich, Elke (2024): Altern. Berlin (Hanser).
Kinsley, Michael (2008): Mine Is Longer Than Yours. In: New Yorker https://www.newyorker.com/magazine/2008/04/07/mine-is-longer-than-yours?utm_source=nl&utm_brand=tny&utm_mailing=TNY_SundayArchive_061224&utm_campaign=aud-dev&utm_medium=email&bxid=5be9eb9c2ddf9c72dc7ea751&cndid=42309081&hasha=5f8acafcb634ad1d21a9374e3afe1572&hashb=aa7942f05dafbc2afa1a0477b78018327877991b&hashc=4677a7b52f3aded92cc5361bf5db24d56c044ee7d09c63c62341f1d68c033eb5&esrc=article-newsletter&mbid=mbid%3DCRMNYR012019&utm_term=TNY_SundayArchive
Klinger, Cornelia (2009): Perspektiven des Todes in der modernen Gesellschaft. Wien/Köln (Böhlau).
Klug, Johanna (2022): Liebe den ersten Tag des Rests deines Lebens. München (Gräfe und Unzer).
Lewina, Katja (2024): Was ist schon für immer. Vom Leben mit der Endlichkeit. Köln (DuMont).
Lévinas, Emmanuel (1996): Gott, der Tod und die Zeit. Wien (Edition Passagen 43).
Muscheler, Karlheinz (2024): Das Recht des Todes. Grundlegung einer juristischen Thanatologie. Berlin (Duncker & Humblot).
Patrick Nehls: Man weiß ja nie… Über: T. Benkel / M. Meitzler (Hg.) (2021): Wissenssoziologie des Todes. In: Jahrbuch Tod und Gesellschaft 2022, 217-219.
Ostaseski, Frank (2017): Die fünf Einladungen. Was wir vom Tod lernen können, um erfüllt zu leben. München (Knaur).
Peuten, Sarah (2023): Todesverdrängung und Einsamkeit der Sterbenden. Relativierung, Aktualisierung, Kontextualisierung. Über: M. Meitzler (2021): Norbert Elias und der Tod. Eine empirische Überprüfung. In: Jahrbuch für Tod und Gesellschaft 2023, S. 195-197.
Radisch, Iris (2015/2020): Die letzten Dinge. Lebensendgespräche. Reinbeck (rororo).
Reuter, Wilfried (2013): Der Tod ist ganz ungefährlich. Buddhistische Hilfen im Umgang mit Alter, Krankheit, Tod. Uttenbühl (Jhana).
Sacks, Oliver (2015/2018): Dankbarkeit. Reinbek (Rowohlt).
Simon, Karin (2023): Vom Bleiben war nie die Rede. Eine Sterbeamme erzählt vom großen Abschied und wie er ohne Angst gut gelingt. München (Knaur).
Simons, Martin (2019): Jetzt noch nicht, aber irgendwann schon. Berlin (Aufbau).
Spiegel, Mirco (2023): Visionen ewigen Lebens – aber wo ist der Transhumanismus? Über: Willmann, T. / El Maleq, A. (2022): Sterben 2.0. (Trans-)Humanistische Perspektiven zwischen Cyberspace, Mind Uploading und Kryonik. In: Jahrbuch für Tod und Gesellschaft 2023, 204-207.
De Ridder, Michael (2017): Abschied vom Leben. Von der Patientenverfügung bis zur Palliativmedizin. Ein Leitfaden. München (Pantheon).
Vieregge, C. Juliane (2019): Lass uns über den Tod reden. Berlin (Links).
Vogt, Fabian (2019): 100 Dinge, die du nach dem Tod auf keinen Fall versäumen solltest. Der kleine Reiseführer durch das Jenseits. (bene).
Wils, Jean-Pierre (1970): Die ungeheure Geschwätzigkeit des Todes. Literaturessay zur Thanatosoziologie. Soziopolis: Gesellschaft beobachten. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-82048-3
Wittmann, Marc / Dietrich, Solveig / Schmidt, Stefan / Vollmer, Tanja (2020): Zeiterleben und Umgang mit Zeit bei Patienten der Onkologie und in der Palliativmedizin. In: Ewald, H.; Vogeley, K.; Voltz, R. (Hrsg.): Palliativ & Zeiterleben. Stuttgart (Kohlhammer), 108–129.
Yalom, Irvin D. (2008): In die Sonne schauen: Wie man die Angst vor dem Tod überwindet. Gebundene Ausgabe. München (btb).
Wittwer, Héctor / Schäfer, Daniel / Fewer, Andreas (Hrsg.) (2020): Handbuch Sterben und Tod. Geschichte – Theorie – Ethik. 2. Auflage. Berlin (Metzler/Springer Nature).
Kinderbücher
Doughty, Caitlin (2020): Was passiert, wenn ich tot bin? Große Fragen kleiner Sterblicher über den Tod. München (C.H. Beck).
Erlbruch, Wolf (2007): Ente, Tod und Tulpe. München (Kunstmann).
Fried, Amelie / Gleich, Jacky (1997): Hat Opa einen Anzug an? München (Hanser).
von der Gathen, Katharina / Kuhl, Anke (2023): Radieschen von unten: Das Buch vom Tod für neugierige Kinder. Leipzig (Klett Kinderbuch).
Köhler, Karen (2024): Himmelwärts. München (Hanser).
Schroeter-Rupieper, Mechthild / Sönnichsen, Imke (2020): Geht Sterben wieder vorbei? Antworten auf Kinderfragen zu Tod und Trauer. Stuttgart (Gabriel Verlag).
Stalfelt, Pernilla (2017): Und was kommt dann? Das Kinderbuch vom Tod. Frankfurt/M. (Moritz Verlag).
Velthuijs, Max (2015): „Was ist das?“, fragt der Frosch. Frankfurt/M. (Sauerländer).
Wild, Margaret; Brooks, Ron (1997): Das Licht in den Blättern. Frankfurt/M. (Moritz).