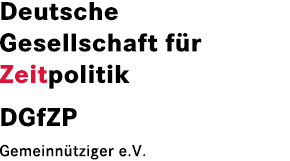Dr. Jürgen Klunker
Zeit der Musik
Anfangsgedanken
Kürzlich, bei einer Geburtstagsfeier, wurde ein Rilke-Gedicht über die Musik zitiert, aus dem mir ein Satz lebhaft in Erinnerung geblieben ist: „Du Zeit, die senkrecht steht auf der Richtung vergehender Herzen.“ Rilke meint die Zeit der Musik.
Für mich als Physiker ist es eigentlich klar: Zeit ist eindimensional und gerichtet. Vorwärts, es gibt kein Zurück. Und kein Links oder Rechts, Oben und Unten. Die Zeit ist wie ein Pfeil, der Pfeil ist geradezu das Symbol der Zeit. Und der Pfeil steht nicht senkrecht, sondern zeigt nach vorne.
Aber es gibt viele Abläufe in der Natur, die nicht linear sind, sondern periodisch auftreten, wie die Jahreszeiten oder die Tag- und Nachtwechsel oder Ebbe und Flut. Das sind alles zyklische Vorgänge, die von astronomischen Bedingungen herrühren. Es gibt auch biologische Ereignisse, die immer wieder auftreten, zum Beispiel unser Herzschlag oder die Atmung oder auch der völlig unrhythmische Wimpernschlag, wir sind umgeben von Vorgängen, die nach ihrer eigenen Zeit ablaufen und an die wir uns gewöhnt haben, ja, die unser tägliches Leben prägen.
Und nun Rilke, mit seiner Hymne An die Musik. Er spricht eine Zeit an, die Zeit der Musik, die senkrecht stehe auf der Richtung der vergehenden Herzen. Die „Richtung der vergehenden Herzen“ ist offenbar diejenige, die wir als die lineare Richtung der Zeit verstehen, die Richtung der Vergänglichkeit, nicht nur der Herzen, sondern aller Dinge, allen Lebens, auch unseres Lebens. Und senkrecht dazu stehe die Zeit, die in der Musik vergeht. Eine Metapher, die mich fasziniert. Es gibt also, folgt man Rainer Maria Rilke, eine Zeit, die zur Musik gehört, die Musik hat eine eigene Zeit, die anders verläuft als die gewohnte Zeit, die Zeit der tickenden Uhr. Sie steht senkrecht auf der Zeit vergehender Herzen. Das ist ein starkes Bild, denn etwas, das senkrecht steht, unterscheidet sich deutlich von der Grundlage, der Geraden, zu der die neue Richtung senkrecht steht. Die Zeit der Musik hat einen anderen Charakter, sie gleicht nicht dem unabänderlichen Pfeil der vergehenden Zeit. Sie verwendet eine andere Dimension. Die Zeit der Musik vergeht auch, aber in einem anderen Maß. Sie vergeht ja nicht wirklich, die Musik kann immer wieder neu erzeugt und gespielt werden. Und ihre Zeit beginnt immer wieder von Neuem. Die Zeit der Musik hat einen Takt, sie macht Pausen, sie
atmet, es ist so, als ob die vergängliche Zeit innehielte, solange die Musik ertönt.
Die Musik und ich
Dieser Gedanke lässt mich nicht mehr los, seit ich das Rilke-Gedicht gehört habe, und ich finde, es lohnt sich, etwas mehr darüber nachzudenken. Musik ist eine Menschen-Erfindung, die ganz besondere Eigenschaften hat.
Musik hat einen Rhythmus, hat eine Struktur, sie enthält Klänge, Melodien und ist mit Gefühlen erfüllt. Musik kann mitreißend sein, jubelnd und erhebend, sie fordert zum Tanz auf, man kann sie singen, sie kann auch traurig sein, schwermütig und klagend. Musik löst Gefühle aus, sie erzeugt eine unbestimmte Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach mehr Musik? Eine Sehnsucht nach einem anderen Leben?
Mir geht Musik oft „unter die Haut“, ich lasse mich auf das Zuhören ein und verfolge den musikalischen Ablauf durch innerliches Mitsingen. Ich versuche, mir vorzustellen, wie die nächsten Takte der Musik klingen könnten. Dabei hilft mir natürlich mein musikalisches Gedächtnis, ich kenne viele Musikstücke sehr gut und kann sie tatsächlich mitsingen. Bei solchen Musikstücken wie der Mondscheinsonate von Beethoven, die ich im Schlaf kenne, macht es mir Freude, den Ablauf der Musik Takt für Takt zu verfolgen und „vorauszuhören“, was als nächstes kommen wird. Dieses Gefühl, mit der Musik mitzugehen, erzeugt in mir eine große Befriedigung, und ich kann mich deswegen auch sehr lange in eine Musik versenken. Die große C-Dur-Symphonie von Franz Schubert hat von einem Kenner das Attribut der „himmlischen Längen“ bekommen, was ich nur bestätigen kann. Die strukturellen Bausteine der Musik mit ihren Variationen und Wiederholungen üben auf mich einen Sog aus, der das Gefühl erzeugt, es müsste
immer so weiter gehen, die Musik sollte nie enden, obwohl alles auf ein Ende hin aufgebaut ist, die Musik türmt sich auf bis zu einem Höhepunkt, nach dem dann aber Schluss ist. Und doch bleibt die Sehnsucht nach einer Fortsetzung, gerade bei Schubert hat die Musik einen Charakter von Endlosigkeit. Und er selbst ist nur einunddreißig Jahre alt geworden.
Das Zeitgefühl der Menschen ist individuell und situationsbedingt sehr unterschiedlich. Wenn ich Musik höre, verliere ich mein Zeitgefühl zwar nicht völlig, aber es wird überlagert von der Eigenzeit der Musik, ich höre in der Musik ihre Zeit und lasse mich davon einhüllen, so dass ich das Vergehen der Uhrzeit einfach vergesse. Ich verfolge den Ablauf der Melodie, wie sie schnell oder langsam, schleppend oder beschleunigend, ritardando oder accelerando, vivace oder presto gespielt wird.
Ob man Gefühle mit Musik ausdrücken kann, darüber streiten sich die Experten. Jedenfalls kann Musik Gefühle auslösen, die dann aber häufig von der Musik ablenken, so dass musikalische Puristen jeden Einsatz von Gefühlen beim Spielen oder Hören von Musik verbieten. Ich persönlich kann und will meine Gefühle beim Hören von Musik nicht unterdrücken, zum Beispiel die Sehnsucht nach Liebe, die mich zum Träumen verführt, beim zweiten Satz des Klarinettenkonzerts von Mozart. Aber davon unabhängig und nicht durch Gefühle beeinträchtigt höre ich die Eigenzeit der Musik, sie wird beim Hören meine eigene Zeit, ich kann sie körperlich spüren.
Die Struktur der Musik
Die Zeit der Musik steht senkrecht auf dem Zeitstrahl, der unser Leben vorantreibt.
Musik läuft in der Zeit ab, sie hat eine zeitliche Struktur, sie ist nicht einfach da wie ein bildnerisches Kunstwerk. Sie ist zwar in einem Notenheft notiert, damit sie nicht in Vergessenheit gerät, aber sie wird erst lebendig, wenn man sie spielt. Wie ein literarischer Text, der erst, wenn er gelesen oder vorgelesen wird, zum Leben erwacht, ansonsten in seinem Buch oder auf seiner Papierseite „schläft“.
Die Musik ist nach Regeln aufgebaut. Vieles von dem, was etwa bei Bach aufgezeichnet ist, war einmal ein Tanz: eine Sarabande, eine Courante, eine Allemande, eine Gigue, ein Menuett. Später wurde die Sonatenform eingeführt, nach der sehr viel klassische Musik strukturiert ist: Exposition, Durchführung, Reprise, Coda. Im Mittelalter gab es einstimmige Gregorianische Gesänge, eine Art von linearer Musik; in jüngster Zeit wurde die Zwölftonmusik propagiert, nach der kein Ton wiederholt werden darf, solange nicht alle zwölf Töne der Tonleiter-Oktave gespielt worden sind. Alles ist von Regeln bestimmt, die den zeitlichen Ablauf der Musik festlegen. Der Rhythmus und die Festlegung der Tonfolge bleibt die Arbeit des Komponisten.
Durch die musikalische Struktur wird die Eigenzeit der Musik fixiert, sie wird nachvollziehbar, interpretierbar. Häufige Wiederholungen führen dazu, dass sich eine Melodie und ein Rhythmus einprägen. Eine Komposition ist musikalisch strukturierte Zeit.
Wenn ich mich in eine Musik hineinhören will, dann muss ich vor allem den Rhythmus erfassen, denn der Rhythmus eines Musikstücks oder einer Melodie ist sozusagen der zeitliche Kern, das Skelett der Musik. Was ist Rhythmus in der Musik? Es ist die bestimmte und sich ständig wiederholende Abfolge von betonten und unbetonten Noten, Einzeltönen oder Akkorden. Der einfachste Rhythmus bei einem Dreiviertel- oder Viervierteltakt besteht zum Beispiel darin, dass immer der erste Ton oder Akkord des Taktes betont wird.
Die Eigenzeit der Musik drückt sich am deutlichsten im Rhythmus des Musikstücks aus. Der Rhythmus stellt die Eigenzeit der Musik dar als Gestalt, als Struktur, und ist deshalb zusammen mit der Melodie und der Häufigkeit ihrer Wiederholungen das Erkennungsmerkmal eines Musikstücks. Ein Beispiel: der bekannte Boléro von Ravel, der mit einem bloßen Trommelrhythmus beginnt, bevor dann die Flöte eine zarte Melodie über der sich wiederholenden Trommel ertönen lässt. Dieser Rhythmus wird dann immer weiter wiederholt, und die Musik rankt sich darum zu einem gewaltigen Klangbild empor. Der Hörer wird dabei allmählich in Trance versetzt. Erst nach der 168sten Wiederholung ändern sich die Tonart und die Melodie, so dass das Stück zu einem glanzvollen Abschluss kommt. Ravel hat hier exemplarisch vorgeführt, was der Rhythmus für die Musik bedeutet. Ursprünglich ist der Boléro für eine Tanzaufführung komponiert worden, was natürlich den elementaren Zusammenhang zwischen Rhythmus und Bewegung verdeutlicht hat. Aber auch ohne Tanz scheint die Musik des Stücks ungeheuer dynamisch zu sein, sie wirkt wie eine einzige, unaufhörliche Steigerung. Dabei bleiben der Rhythmus und das Tempo, also die Zahl der Takte pro Minute, absolut unverändert. Es gibt zwar eine dauernde Steigerung der Lautstärke, ein Crescendo, und der Orchesterklang wird durch immer neue Instrumente, die einstimmen in die Musik, ständig verändert und verdichtet, aber die Melodie des Stücks wiederholt sich in Variationen und bleibt damit auf der Stelle. Hier wird deutlich, dass die Eigenzeit der Musik auch heißen kann, dass außer einem Kreisen um eine enge Mitte keine Bewegung stattfindet.
Der Takt und die Musik
Wer als Kind Klavierstunde gehabt hat, kennt das Ding. Ein kleines lackiertes Kästchen steht auf dem Klavier und macht tak-tak-tak-tak, unerbittlich. Es gibt den Takt vor, oder besser, es gibt die Zeit vor, die der Klavierschüler hat, um einen Takt zu spielen. Zum Beispiel beim Viervierteltakt sind es vier Schläge, für jedes Viertel einen, und dazu gehört dann eine Angabe, wie viel Takte pro Minute zu spielen sind. Bei Übungsstücken steht diese Angabe über den Noten des Klavierstücks, bei manchen Kompositionen hat der Komponist das Tempo mit einer solchen Angabe festgelegt. Ob sich der Musiker oder die Musikerin daran halten, ist eine andere Frage. Wenn viele Musiker zusammenspielen, brauchen sie einen Dirigenten, der den Takt mit seinen Hand- oder Armbewegungen sichtbar macht.
In einem Popkonzert spielt der Takt auch eine große Rolle. Meistens werden die Bässe, die sich akustisch ohnehin durchsetzen, mit elektronischer Verstärkung so laut gespielt, dass sie physisch spürbar sind. Und die Taktfrequenz liegt über der Herzfrequenz, so dass „die Herzen schneller schlagen“, weil die Bässe schneller wummern.
Ein besonderes Kapitel ist der Dreivierteltakt, eine Wiener Erfindung, die eng mit dem Walzertanz verbunden ist. Ein Musikstück im Dreivierteltakt strahlt eine Beschwingtheit und eine Fröhlichkeit aus, die einen zum Tanz drängt und in einem das Gefühl des Drehens verursacht. Aber die Wiener Erfindung ist eigentlich gar keine: Wer genau hinhört, erkennt auch schon in der Matthäuspassion von Bach eine Aria im Dreivierteltakt, die eigentlich gar nichts Heiteres hat, aber doch etwas Vorwärtsdrängendes, Beschwingtes, was mit der Traurigkeit des Passionsgeschehens so gar nicht zusammenpasst. Kann es das geben, eine musikalische Eigenzeit im Dreivierteltakt? Sicherlich, das Drehen im Kreise ist damit sozusagen manifest verbunden. Die Zeitverhältnisse in einem Walzer sind ansonsten sehr konventionell; außer der Drehbewegung ist an einem Walzertakt nichts Besonderes.
In den Alpenländern gibt es einen speziellen Tanz, den Zwiefachen, bei dem der Takt nach bestimmten Regeln zwischen einem Zweier- und einem Dreiertakt wechselt. Das führt beim Hörer zu einem erstaunten Aufhorchen, was ist da los? Man kommt ins Stocken, wenn der Takt wechselt, aber nach einigen Wiederholungen gewöhnt man sich an diesen eigenartigen Rhythmus, so wie die Tänzer auch, die diesen Wechsel längst gewöhnt sind und keinesfalls ins Stolpern geraten deswegen.
Also: keine Musik ohne Takt!? Natürlich gibt es Ausnahmen, wie immer. John Cage hat ein Musikstück geschrieben, das ohne Takt auskommt, denn nur alle zweieinhalb Jahre wird der Klang der Orgel in Halberstadt gewechselt. Das Musikstück dauert 639 Jahre. Aber auch in Halberstadt verläuft die Zeit der Musik senkrecht zur üblichen Zeit. In der Werbebroschüre steht: „Wer es hört, hat das Gefühl, ein kleines Stück Ewigkeit zu erfahren“.
Die Melodie – ein musikalisches Bild?
Kann ich Musik hören, wie ich ein Bild betrachte? Nein, denn vor einem Bild kann ich stehen bleiben und jedes Detail so lange anschauen, wie ich will. In der Musik ist jedes Detail schon vorbei, sobald ich es wahrgenommen habe (außer an der Orgel in Halberstadt). Musik ist an die Zeit gebunden, die Abfolge von Tönen und Klängen kann nur im Lauf der Zeit erfolgen. Man kann auch viele Töne auf einmal spielen, dann entsteht ein Cluster, der aber für sich genommen noch keine Musik darstellt.
Das Wiederholen einzelner Töne oder Klänge oder von Tonfolgen, also zum Beispiel von Melodien, ist ein wichtiges Prinzip der Musik, denn durch die Wiederholung prägt sich ein musikalischer Ablauf ein, und man erinnert sich daran, wenn er wieder ertönt. Ein musikalisch begabter Mensch kann dann sehr bald eine Melodie nachsingen, und auf diese Weise die zeitliche Struktur eines Musikstücks erfassen. Aber es ist eben nicht nur die zeitliche Struktur, die ein Musikstück ausmacht, sondern die Abfolge der Tonhöhen, die Zusammensetzung der Klänge aus vielen, gleichzeitig erklingenden Tönen und die Art der Wiederholung.
Die Musik – ein Programm?
Die Komponisten der Romantik haben angefangen, ihre Musik mit außermusikalischen Themen zu verknüpfen. Beethoven war einer der ersten mit seiner Symphonie „Pastorale“, deren einzelne Sätze Überschriften tragen wie „Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande“. Später hat sich der Name „Programmmusik“ für diese Kategorie durchgesetzt. Damit wird die Rolle der musikalischen Eigenzeit zurückgedrängt von der Zeit, die mit dem Programm verbunden ist, also etwa dem – zeitlich gerafften – Ablauf eines Gewitters in der Pastorale. Dabei wird die Struktur der Musik nicht in Frage gestellt, und es ist die Kunst des Komponisten, die programmatische Zeit und die Eigenzeit der Musik zu verknüpfen.
Das Zusammenspiel mehrerer Instrumente in einem Orchester ist sozusagen die Quintessenz von Musik. Nur auf Basis einer Komposition, die alle Einzelheiten für jedes Instrument festlegt, kann ein Orchesterstück entstehen. Wenn jeder Musiker und jede Musikerin für sich frei improvisieren wollte, ergäbe das musikalisches Chaos. Auch das ist in modernen Zeiten schon ausprobiert worden, und im Jazz hat das Improvisieren einen festen Stellenwert, aber meist in der Form, dass das jeweilige Soloinstrument improvisiert, während die übrigen Mitglieder der Combo die Begleitung übernehmen. Musik war im Mittelalter und in den ersten Jahrhunderten der Neuzeit strengen Regeln unterworfen, die Komponisten hatten wenig Freiheiten beim Komponieren.
Die Musik – ein Drama?
Die Dramatik der Musik kann auch, im Extremfall, zu Nervenzusammenbrüchen und Trancezuständen führen. So geschehen bei der Uraufführung des „Sacre du Printemps“ von Strawinski im Jahre 1913 in Paris. Das Musikstück hat einen der größten Skandale der Musikgeschichte verursacht, es ist eine wilde Musik, zu der ein Ballett – meist auch sehr wild – getanzt wird. Die Eigenzeit bei Strawinski wechselt häufig den Takt, vor allem zu einem noch höheren Tempo, mit dem die Tänzer (und das Publikum) aufgepeitscht werden sollen.
Noch dramatischer geht es zu in der Oper, wo eine Bühnenhandlung mit Musik unterlegt und durch Gesang intensiviert vorgespielt wird. Hier überlagern sich mehrere Eigenzeiten, die der Bühnenhandlung, die der Musik und die des Zuschauers, was leicht zu einer Überlastung des Zuschauers/Zuhörers führen kann
Musik bewegt die Seele
Musik bewegt die Menschen, berührt ihre Seele. Ich verwende das Wort Seele nur mit Vorsicht, weil ich nicht weiß, was die Seele eigentlich ist. Was geschieht in der Seele, was geschieht im Menschen, wenn er sich von Musik berühren lässt? Meine Erfahrung, und nur davon kann ich hier sprechen, ist eine tiefgreifende: mich hat Musik schon immer angerührt, ich bin mit und durch Musik erwachsen geworden. Anton Bruckner mit seinen symphonischen Klangtürmen, der Anfang von Franz Schuberts weltabgewandter Klaviersonate in B-Dur, Mozarts herrliche Melodien in der Kleinen Nachtmusik, die so einfach aufgebaut und so eingängig sind, dass man danach tanzen könnte – die Musik ist so reich an wunderbaren Werken, ich erlebe sie nun schon mein ganzes Leben und habe doch nie genug davon. Mein Inneres, meine Seele sehnt sich nach Musik, die mich anrührt. Ich spüre mich selbst in der Musik, die Musik wird Teil von mir, oder ich werde Teil von ihr. Ich gehe in ihr auf.
Aber die Worte beschreiben nicht wirklich, was mit mir passiert, wenn ich „meine“ Musik höre, ich kann es nur mit etwas abgenutzten Floskeln darstellen und komme doch an das Geheimnis der Musik nicht heran. Ich kenne keinen Menschen, keinen Buchautor, der dieses Geheimnis zu lüften vermocht hat, nicht einmal Adorno in seinem Buch über Beethoven hat das vermocht. Er hat es nicht einmal versucht. So bleibe ich zurück mit einer unvollständigen Beschreibung dessen, was mit uns geschieht, wenn wir Musik hören, ich kann es nicht völlig erklären. Aber dass Musik ihre eigene Zeit hat, die anders verläuft als unsere ständig vergehende Alltagszeit, das ist wohl richtig. Ich wünsche mir jedenfalls, dass Musik nie vergeht.
Dr. Jürgen Klunker,
Mitglied der DGfZP, Diplomphysiker