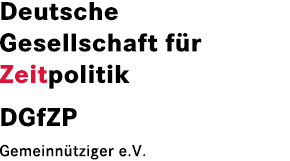Dr. Susanne Schroeder
Rezension:
»Zeit-Hören: Erfahrungen – Taktungen – Musik« von Norman Sieroka

Norman Sieroka studierte Philosophie, Physik und Mathematik an den Universitäten Heidelberg und Cambridge und ist seit 2019 Professor für Theoretische Philosophie an der Universität Bremen. Deshalb fühlt man sich als Geisteswissenschaftlerin bei seinen Erläuterungen zum Begriff der Zeit wunderbar aufgehoben und glaubt ihm Äußerungen, die man in lockerer Literatenrunde zumindest argwöhnisch betrachten würde. Zum Beispiel die Feststellung, dass es „die Zeit“ gar nicht gibt, mit der er seine Betrachtungen über Philosophie, Musik und den taktvollen Umgang mit Zeit einleitet. Wir ordnen aber trotzdem alles, was wir erleben, zeitlich, und diesem Vorgehen liegt ein zentraler Bezug auf Verhältnisse und Taktungen zugrunde. Womit schon ein wesentliches Stichwort dieser Untersuchung genannt ist: denn Norman Sieroka verwendet die Betrachtungen von Takt, Taktungen und Wiederholungen als wesentliche Strukturelemente der Musik dazu, uns Zeitstrukturen in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens besser erkennen zu lassen und näherzubringen. Damit dies gelingt, stellt er eine ausführliche Playlist mit Hörbeispielen aus Klassik und Jazz, aber auch Klangströmen und Geräuschen zur Verfügung, die man im Internet abrufen kann. Sieroka will uns keine theoretischen, allgemeingültigen Wahrheiten einsichtig machen und vor Augen führen, sondern er will uns darauf einstimmen, zeitliche Strukturen zu erleben. „Statt eines distanzierten Überblicks über eine Welt, die einem gegenübersteht, geht es darum, bestimmten zeittheoretischen Fragestellungen neu Gehör zu verschaffen und durch den Bezug zu Musik und Hören einen Einklang zu erzeugen mit dem, was um uns und mit uns geschieht.“
Formulierungen wie „Einsichtig machen“, „vor Augen führen“ oder „Überblick schaffen“ entstammen einem anderen Sinnesbereich als Wendungen wie „einstimmen“, „Gehör verschaffen“, Einklang erzeugen“. Sie weisen auf ein wesentliches Problem des Zeitverstehens hin, das als „Zeit-Versehen“ vor allem im 2. Kapitel unter der Ergänzung „Sinnlose Beschwerden über eine vergegenständlichte Zeit“ genauer betrachtet wird. Sieroka konstatiert in Hinblick auf die Beschreibung zeitlicher Phänomene eine große Anzahl irreführender Redeweisen, die vor allem aus problematischen Vergegenständlichungen resultieren. Wenn Zeit aber keine Substanz ist, sind dinghafte Umschreibungen irreführend. Sieroka vermutet neben einer gewissen sprachlichen Bequemlichkeit auch das Bedürfnis nach einer visuellen Fixierung. Visuelle Metaphern haben den Vorteil, die augenfälligeren zu sein, sie leuchten schneller ein, führen einfacher zu Einsichten, veranschaulichen Meinungsbilder und prägen Weltanschauungen. Aber was soll sich bei einer „Zeitenwende“ ändern, soll die Zeit da rückwärts laufen oder wird sie wie eine Wendejacke „auf links gedreht“? Was konkret wird bei einer „Zeitumstellung“ umgestellt? Wie läuft man „Zeitkorridore“ entlang und schaut durch „Zeitfenster“? Das gleiche gilt für die gegenwartstypisch charakteristischen Begriffe des „Zeitdrucks“, „Zeitverlusts“, „Zeitgewinns“ oder der „Zeitersparnis“. Ökonomische Redeweisen über Zeit sind, so Sieroka, ohne Zweifel dann sinnvoll, wenn über Arbeitszeiten und Stundenlöhne gesprochen wird – dies zur Rechtfertigung der Deutschen Gesellschaft für Zeitpolitik. Aber in der gleichen Weise über individuelles Zeiterleben zu sprechen muss eher irritieren oder verstören. Diesen Beschreibungen eines allgegenwärtigen „Zeit-Versehens“ kontrastiert Sieroka im 3. Kapitel das „Zeit-Verstehen“, in dem Zeit als Dimension von Ereignissen charakterisiert wird. Die Beschwerde, dass die Zeit „immer schneller vergehe“, birgt in sich zwar die missverständliche Unterstellung, Zeit könne „gehen“, verdeutlicht aber gleichzeitig ganz richtig, dass es hier um ein Verhältnis zwischen Ereignissen beziehungsweise Ereignisketten geht. „Denn nur über solche Verhältnisse lässt sich überhaupt etwas über die vermeintliche „Geschwindigkeit der Zeit“ aussagen… Nicht die Geschwindigkeit „der Zeit“ kann zunehmen, aber die Anzahl von bestimmten Ereignissen in Relation zur Anzahl anderer Ereignisse.“ (21f.) Diese Ereignisse sortieren wir in Ordnungen von früher-später oder von vergangen-gegenwärtig-zukünftig (25). Dabei kommen unterschiedliche Beschreibungsinteressen zum Tragen, denn wie bestimmt sich der Anfang oder das Ende eines Ereignisses? Welche Zeitspanne umfassen die gegenwärtige Legislaturperiode, die gegenwärtige Theaterspielzeit oder das gegenwärtige Erdzeitalter? (26). Diese Beispiele illustrieren die sympathische Bodenhaftung, mit der Norman Sieroka uns durch das Dickicht der Begrifflichkeiten führt. Selten wurde die Motivation zum Uhrenbau anschaulicher beschrieben, um darin zu kulminieren, dass es hierbei lediglich darum ginge, das Zueinander-in-Beziehung-Setzen von physikalischen Ereignissen möglichst universell und einfach zu gestalten (29). Die Pointe beim Verwenden einer Uhr besteht, so führt er aus, gerade darin, eine Anzahl von sinnlich wahrnehmbaren Ereignissen mit anderen Ereignissen zu vergleichen. Nur so komme ich zu Aussagen wie ‚Das Ei hat vier Minuten gekocht‘. Solche Zuschreibungen sind nicht deshalb möglich, weil alles auf Physik reduzierbar ist, sondern weil sämtliche Ereignisse zeitbehaftet und mindestens ihrer Anzahl nach miteinander vergleichbar sind (29).
Wie eben erwähnt, geht es bei der Zeitbeschreibung um ein Verhältnis zwischen Ereignissen beziehungsweise Ereignisketten. Hierbei haben kausale Aussagen den Vorrang vor raumzeitlichen. Diese Besonderheit der Zeit gegenüber dem Raum verdeutlicht Sieroka am Beispiel der Tätersuche im Krimi. Hier gilt es als Alibi, wenn man nachweisen kann, zur gleichen Zeit an einem anderen Ort gewesen zu sein. Der Nachweis, am gleichen Ort zu einer anderen Zeit gewesen zu sein, wäre wenig hilfreich. Denn nur im ersten Fall kann ein direktes Verursachungsverhältnis für die fragliche Tat ausgeschlossen werden (33).
Im 4. Kapitel geht es nun um „Zeit-Variationen“, um das Zusammenspiel von Wiederholung und Neuerung als den wesentlichen Elementen zeitlicher Ordnungen. Wiederholungen von Erlebnissen und Ereignissen bieten Rückhalt und Stabilität im Wiedererkennen. Immer wieder das Gleiche zu erleben wäre aber eintönig und ermüdend. Es bedarf also eines gewissen Maßes an Neuerung als Element des Schöpferischen und Kreativen. Ein gutes Zusammenspiel von neuen und sich wiederholenden Ereignissen ist Voraussetzung für ein gelingendes Lebensgefühl sowohl auf der individuellen als auch auf der sozialen Ebene.
Jetzt steht das begriffliche Instrumentarium zur Verfügung, um es in Musik- und Hörerfahrungen erlebbar zu machen. In den Kapiteln 5 und 6 wird, unterstützt von vielen nachhörbaren Beispielen, das Hören von Musik und Klang als zeitliche Gestaltungsleistung herausgearbeitet. Sieroka hofft, dadurch bestimmte und möglicherweise neue Erfahrungen anstoßen zu können. „Vielleicht kann ja nicht nur der Respekt vor der Zeitbehaftetheit unserer Erfahrungen gesteigert werden, sondern kann mit dem Hören als Mustererfahrung auch die erlebte Wirklichkeit neue zeitliche Gestalten annehmen, kann sich erweitern beziehungsweise ihren Kontrastreichtum steigern.“ (135)
Voraussetzung dafür ist allerdings ein aktives Hinhören. Das 7. Kapitel beschreibt dies unter dem Motto „Zeitliche Symphonie“ als eine Voraussetzung, um sich „im Takt“ intakt zu fühlen und so einen autonomen Umgang mit der Zeit zu üben. Denn viele Gesundheitsfragen entpuppen sich bei näherem Hinsehen als „Zeit-Störungen“. Sieroka bezeichnet sie als pathologische Taktverluste und belegt dies mit Beispielen, die eine nicht gelingende Integration der Zeitextasen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft beschreiben (104). Flasbacks, posttraumatische Belastungsstörungen, das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, Süchte, Autismus, bipolare Störungen – sie alle zeichnen sich durch Besonderheiten des Zeiterlebens aus. In vielen dieser Kontexte wird Musik zu Therapiezwecken verwendet, um Resynchronisierungsprozesse anzuleiten oder – quasi noch unterhalb der kognitiven Ebene – über Rhythmen und Klänge das Wiedererleben retentionaler und protentionaler Bezüge zu trainieren. So soll der erlebten Zukunftslosigkeit und dem Zusammenbruch einer dynamisch wahrzunehmenden Gegenwart entgegengewirkt werden (109). Gelingt dies, kann der Alltag wieder in seiner Polyrhythmik wahrgenommen werden. Hier gilt es, vieles hören zu können und dabei Gleichklang zu bewahren. Ein gelingender Alltag bedarf eines guten Rhythmus, einer austarierten, wohltemperierten Mischung aus Vertrautem und Neuem, einem Gleichgewicht zwischen Tun und Lassen, Wiederholen und Erneuern. Wieviel Können steckt in guter Musik und in gelingendem Leben! Norman Sieroka setzt uns mit seinem Buch auf eine gute Fährte.
Norman Sieroka: „Zeit-Hören: Erfahrungen – Taktungen – Musik“. In der Reihe „CHRONOI – Zeit, Zeitempfinden, Zeitordnungen, Time, Time Awareness, Time Management“ – Herausgeben von Eva Cancik-Kirschbaum, Christoph Markschies und Hermann Parzinger im Auftrag des Einstein Center Chronoi, Band 12.
2024 publiziert von Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston.
Dieses Buch ist als Open-Access-Publikation verfügbar über www.degruyter.com.
Susanne Schroeder