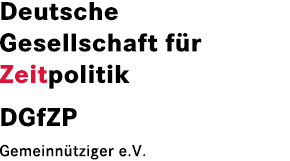Dr. Susanne Schroeder
Der Tod der Toten
Was kann man über den Tod aussagen? Eigentlich nichts. Denn erfahren haben ihn nur die Toten, und mit denen können wir nicht sprechen. Somit schließt sich eine wie auch immer historische Erforschung eigentlich aus, da ihr das Subjekt fehlt. Genau deshalb müssen wir uns, wenn wir Epikur lesen, vor dem Tod auch nicht fürchten. Denn wo er ist, sind wir nicht, und wo wir sind, ist er nicht. Aber Logik tröstet nicht. Sokrates war in der unmittelbaren Nähe seiner Betroffenheit deshalb auch vorsichtiger, wenn er davon sprach, dass er nichts über ihn wisse. Denn darum dreht sich seine Apologie – nicht um alles Wissen und nicht um das sichere und tragfähige Fachwissen oder ein durch Normen vereinbartes ethisches Wissen, sondern um das Nichtwissen vom Tod. „Denn den Tod fürchten, ihr Männer, das ist nichts anderes, als sich dünken, man wäre weise, und es doch nicht sein. Denn es ist ein Dünkel, etwas zu wissen, was man nicht weiß. Denn niemand weiß, was der Tod ist, nicht einmal, ob er nicht für den Menschen das größte ist unter allen Gütern. Sie fürchten ihn aber, als wüßten sie gewiß, daß er das größte Übel ist. Und wie wäre dies nicht eben derselbe verrufene Unverstand, die Einbildung, etwas zu wissen, was man nicht weiß!“ 1
Thomas Macho erläutert in seinem einschlägigen Artikel über den Tod für das Handbuch Historische Anthropologie in Anspielung auf Philippe Ariès, dass eine „Geschichte des Todes“ genauer nur eine Historiographie der menschlichen Beziehungen zum Tod sein könne, aber selbst diese Definition an der Ungreifbarkeit des „Beziehungspartners“2 kranke. Mit der für ein anthropologisches Handbuch erstaunlichen Feststellung, dass ein kulturelles Verhältnis zum Tod nicht als „anthropologische Konstante“ verstanden werden kann, weil sich die uns geläufigen Befürchtungen und Ängste erst in neuzeitlicher Aufbruchstimmung durchgesetzt haben, gibt er uns einen entscheidenden Fingerzeig: Die meisten prämodernen Gesellschaften ließen sich nämlich durch ihre Beziehung zu den Toten charakterisieren – sie kümmerten sich um die Toten, nicht um den Tod.
Der Tod wurde als wirklich erfahren in der Epiphanie des Toten, im Erschrecken über den Toten als das Double des vorher Lebenden: Menschlich und unmenschlich zugleich, vertraut und fremd, menschlicher Organismus und zugleich Ding mit Gesicht, Augen, Mund, Nase. Er sieht niemand an, er „durchschaut“ sein Gegenüber, das als Überlebender dasteht (940 f.). Diesem Anblick des Toten versuchte man zu entgehen, nicht „dem Tod“. Neuzeitlich bedeutete das, den Toten in ein eigenes Zimmer zu legen, außerhalb der eigenen Räume, möglichst in ein anderes Haus, ein Krankenhaus, ein Sanatorium…
Wie aber gestalteten – und gestalten sich auch heute noch an manchen Orten – die Beziehungen zu den Toten, wenn es nicht primär um eine Abschottung, sondern um einen gezielten Umgang mit ihnen geht?
Thomas Macho stellt fest, dass von den Anfängen eines bewussten Umgangs mit dem Tod wenig bekannt ist. Es gibt zwar Spekulationen über prähistorische Totenrituale, Kannibalismen und rituellen Verzehr von Toten, aber von den Gräbern her sind keine Hinweise auf den Glauben an ein Fortleben nach dem Tod belegt. Vielleicht kommen hier eher unsere eigenen Ängste und Phantasien zu Wort (942). Erst mit der neolithischen Revolution und dem damit verbundenen temporalen Umsturz – denn mit einer Landnahme war nun auch eine zeitliche Reihung nötig, die Ahnen und Erbschaftsverhältnisse zur Begründung des Landbesitzes installierte – wurde es wichtig, die Toten, die auf der Jagd umgekommen waren, auf heimatlichem Boden zu begraben (943). Gemeinschaftsgräber, unabhängig von der sozialen Stellung, sicherten die kollektive Identität der Gruppe.
Die an vielen Orten anzutreffenden Skelettierungsmaßnahmen – die Präsentation der Toten auf Hügeln, um sie von Geiern entfleischen zu lassen und danach erneut zu begraben, fanden nicht aus gesundheitlich-hygienischen Gründen statt, denn es wäre einfacher gewesen, die Leichen in ausreichender Entfernung von der Wohnstätte abzulegen. Stattdessen trennte man im neolithischen Jerusalem (8000 Jahre v. u. Z.) die Schädel von den Körpern und unterwarf sie einer besonderen Konservierung. Nachdem man sie in Lehm zu menschlichen Gesichtern ausgeformt, bemalt und mit Augen aus Kaurimuscheln ausgestattet hatte, wurden sie an speziellen Orten aufgestellt. Ähnliche Zeremonien wurden in Neuguinea, Melanesien, Nordsumatra oder Madagaskar beobachtet. Ab dem 6. Jahrtausend v. u. Z wurden die Ahnenschädel durch Gesichtsurnen ersetzt, in denen die Knochen der Verstorbenen aufbewahrt wurden. Sarkophage – übersetzt: „Fleischverzehrer“ – repräsentieren die weitverbreitete Praxis, Gebeine nach ihrer Verwesung und Austrocknung in Urnen beizusetzen. All das – das Entfernen des Fleisches von den Knochen, Abtrennen der Schädel, Modellieren von Schädeln, Öffnen von Gräbern, Umlagern verwester Gerippe – war schwere und unangenehme Arbeit – warum? Zur Versöhnung und Besänftigung der Toten? Macho konstatiert als Anlass einen tiefen Schrecken, der offenbar aus der Konfrontation mit den Toten entspringt. „Denn ebenso gewiss wie der Tote ein bestimmter, identifizierbarer, benennbarer und genealogisch legitimierter Angehöriger bleibt – und zugleich nicht bleibt, ebenso gewiss ist er tot, – und lebt doch tatsächlich (in einem ganz und gar unmetaphysischen Sinn) weiter.“ (944)
Der Tod ereignet sich nicht in einem Augenblick als Überschreitung einer Grenze. Wenn man Walter Benjamin vertraut, ist es ein sehr langer Prozess: „Produktion der Leiche ist, vom Tode her betrachtet, das Leben. Nicht erst im Verlust von Gliedmaßen, nicht erst in den Veränderungen des alternden Körpers, in allen Prozessen der Ausscheidung und der Reinigung fällt Leichenhaftes Stück für Stück vom Körper ab. Und kein Zufall, dass gerade Nägel und Haare, die vom Lebenden weggeschnitten werden wie Totes, an der Leiche nachwachsen“3 (945). Dieser Prozess macht Angst, denn er bereitet Qualen, Schmerzen, Gestank.
Die eigentliche Leistung aller komplexen Bestattungs-, Skelettierungs- oder Kremierungsmaßnahmen besteht in der Erreichung dieses Ziels: Den Gestorbenen in ein „geradezu kristallines, anorganisches Ensemble von Knochen und Ascheresten“ zu verwandeln (945). Denn erst das Skelett oder die Asche beweisen das Ende, den Abschluss des Übergangs vom Leben zum Tod. Dieser Übergang muss möglichst präzise begleitet werden und zu diesem Zweck haben sich verschiedene Formen der rites de passage herausgebildet – Trennungs-, Umwandlungs- und Angliederungsriten. Sie helfen bei der anfänglichen Verarbeitung des ersten Schocks und der letztendlichen Eingliederung in den Totenort, vor allem aber begleiten sie auf der Reise – denn kaum ein anderes Bild hat sich, wie Macho resumiert, im Laufe der Metaphorisierung des Todes stärker eingeprägt als das der Reise (946). Ausgerechnet den sesshaften Kulturen begann der Tod sich als Wanderung zu veranschaulichen, die oft von Schwierigkeiten, Gefährdungen und Prüfungen geprägt war. So beschreiben die Ägyptischen Unterweltsbücher nicht nur die Topographie, damit die Seele den richtigen Weg findet, sondern geben auch konkrete Anweisungen, was der Verstorbene bei diversen Prüfungen zu tun und zu antworten hat. Die Liturgie des Seelenaufstiegs der gnostischen Mandäer beschreibt eine 45-tägige Jenseitsreise, bei der die Seele die Sphären der Planeten und Tierkreise passieren muss. Im Tibetischen Totenbuch werden Techniken zur Suche des Ortes der Wiedergeburt erklärt, südamerikanische Ethnien beschreiben, wie die Seele zwischen zwei Wegen wählen muss, von denen nur der schwierigere ein neues Leben im Totenreich ermöglicht. Immer geht es darum, diesen Übergang erfolgreich zu meistern, denn andernfalls kann die Seele keine Ruhe finden und die in diesem Fall wiederkehrenden Toten irren als Totengeister auf der Erde umher und erschrecken die Lebenden oder erinnern sie, die nötigen Rituale abzuschließen, so dass der Tote ins Jenseits gelangen kann.4
Ihre diesseitige Entsprechung findet die Totenreise deshalb in der Trauerzeit (947). Denn hierbei handelt es sich um die Zeit, die mit der Verwesungsdauer der Leichen korreliert – und auch die Trauerzeiten der Hinterbliebenen unterscheiden sich kulturell deutlich und sind teilweise mit komplizierten Verhaltensregeln und Tabus verbunden. Wir haben es mit einer befristeten Koalition zwischen Toten und Überlebenden zu tun, deren Zweck es ist, sicherzustellen, dass der Tote sein Reiseziel erreicht – und weg ist. Die gelegentlich zu beobachtende „Rückkehr“ der Toten widerspricht dem nicht und hat ihre eigene Logik, denn jede Grenze, so Macho, „lässt sich dauerhaft nur behaupten, wenn sie gelegentlich geöffnet wird“ (949).
Deshalb halten viele Gesellschaften den sozialen Kontakt mit ihren Toten aufrecht, indem sie zu bestimmten Zeiten an bestimmte Orte eingeladen werden. Auch hier spielen Masken eine wesentliche Rolle. In wie schon erwähnt aufwändigen Verfahren versuchte man, der Individualität der Verstorbenen gerecht zu werden und schuf jeweils beeindruckende Originale – ob in Afrika (am oberen Senegal heißen sie „Dou-Mama“ – Vorfahren, in Kamerun „Egbo“ – Geist, am unteren Kongo bis zum oberen Sambesi „Mukisch“, „Akisch“ – Tote, Ahnengeister) oder in Venedig. Denn auch der Karneval hat sich aus rituell-orgiastischen Totenprozessionen entwickelt. Zwar verbot schon im 9. Jahrhundert eine Verfügung des Hincmar von Reims das Tragen von Dämonenlarven, aber noch im 18. Jahrhundert war die Verkörperungskraft von Masken so wirkmächtig, dass im „Erzbistum Salzburg Leuten, die in der Perchten-Maske den Tod fanden, das christliche Begräbnis verweigert wurde“ (950). Von den ekstatischen, von rasenden Mänaden begleiteten Dionysien bis hin zur noch heute beschworenen Wilden Jagd lässt sich durch alle Zeiten und in allen Erdregionen eine Überzeugung konstatieren: Die Toten existieren irgendwie und irgendwo weiter, aber wenn die jeweiligen Bestattungs- und Trauerregeln befolgt werden, überschreiten sie die Grenze zum Land der Lebenden nicht willkürlich (951).
Philippe Ariès diagnostiziert mit dem Beginn der Neuzeit einen Verfall dieser Ordnung und einen Prozess der „Verwilderung des Todes“.5 Zwar würde nicht der Tod verdrängt, aber die Toten. Belege dafür sind neben anderen, bereits erwähnten Phänomenen die Verlagerung der europäischen Friedhöfe an die Peripherien und ihre Verwandlung in Parkanlagen. Die Auffassung, dass, was bleibt, nur ein Ding ist, die Leiche, erleichtert der modernen, wissenschaftlichen Medizin im Zuge des neuzeitlichen Säkularisierungsprozesses die Arbeit (951). Und mit der geschwundenen Angst vor der Wirkmacht der Toten geht insgesamt ein Bedeutungsverlust einher, der ihre Rolle im Leben und Treiben schmälert und ebenso die der Sterbenden als Träger dieser Wirksamkeit.
Thomas Macho hat dieser Beobachtung niemals zur Gänze getraut. Nicht umsonst bestätigen Umfragen nach wie vor die unterschiedlichsten Jenseits- oder Wiedergeburtsvorstellungen. Unübersehbar statten sich vor allem diktatorische Regime weiterhin mit ausufernden Totenkulten aus. Und die Funeralkultur treibt in Abkehr schwarzer Farbvorgaben bunte Blüten. Was ihm aber besonders ins Auge fällt, ist eine Unsterblichkeitsidee, die seit zwei Jahrhunderten als Jenseitsersatz aufgeboten wird: Dass die Toten nämlich nicht im Himmel, sondern in uns selbst weiterleben. Für ihn ist das eine der unheimlichsten Vorstellungen, die jemals entwickelt wurde. Diese Form der Besessenheit in Form von Poltergeistern oder Zombies illustriert die meisten Grusel- und Horrorfilme und sitzt am Tisch aller spiritistischen Versammlungen. Diese Besessenheit als Konsequenz einer womöglich fehlerhaften oder ordnungswidrigen Bestattung musste in älteren Kulturen kultisch geübt und reguliert werden, um nicht zu permanenter Verstörung zu führen. Macho übersetzt Ariès’ Verwilderung des Todes als „vampiristisches Unsterblichkeitsphantasma“ (953). Aber er empfiehlt keine Rückkehr zu alten Totenkulten und Ritualen. Jedes rational-funktionalistische Kalkül birgt die Auslieferung an alte Vorstellungen der Schuld und des Opfer(n)s. Vielleicht braucht ein liebevoller und kluger Umgang mit den Toten die Entwicklung neuer Rituale…
Dr. Susanne Schroeder,
Mitglied der DGfZP,
Kulturwissenschaftlerin
- https://www.projekt-gutenberg.org/platon/apologie/apo004.html – Hinweis darauf in Rentsch, Thomas: Fürsorge am Lebensende – Philosophische Grundlagen in: Kumlehn, Martina Hrsg. Kubik, Andreas Hrsg.: Konstrukte gelingenden Alterns, Kohlhammer Verlag, 2012, 24-25 ↩︎
- Macho, Thomas: Tod in: Wulf, Christoph Hrsg: Vom Menschen. Handbuch Historische Anthropologie, Beltz Verlag, 1997, 939-956 – der vorliegende Artikel gibt den Inhalt dieses Textes wieder, die Zahlen in den Klammern beziehen sich auf die Seiten dieses Buches. ↩︎
- Benjamin, Walter: Ursprung des deutschen Trauerspiels in: Gesammelte Schriften, Bd.1. Frankfurt/M. 1974, zitiert nach Macho a.a.O. ↩︎
- Metzler-Lexikon Religion, Artikel „Sterben“, Bd.3, Stuttgart 2005 ↩︎
- Ariès, Philippe; Geschichte des Todes, München/Wien 1980 zitiert nach Macho a. a. O. ↩︎