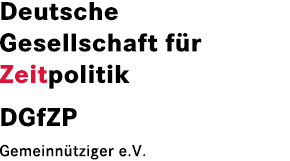Dr. Jürgen P. Rinderspacher
Tod und Sterben als Zeitproblem
Die Welt ist durch und durch eine zeitliche Veranstaltung des Werdens und Vergehens, der Entstehung von Strukturen und ihres Verfalls, des Kommens und Gehens. Insofern geht das Thema „Tod und Sterben als Zeitproblem“ gewissermaßen ins Epizentrum jeder zeitlichen Theorie, die schon Aristoteles und einige Jahrhunderte nach ihm Augustinus als die Bewegung, das Hin und Her und Auf und Ab, als unabdingbare Voraussetzung für die Existenz von Zeit überhaupt konzipiert hatten. Also ist es eigentlich folgerichtig, auch mal über das Werden und Vergehen des menschlichen Körpers und, falls man daran glaubt, seiner Seele zu sprechen – sowohl was die einzelne Person, als auch was die jeweilige Kultur oder Zivilisation betrifft, innerhalb derer Geborenwerden, Sterben und Totsein sich abspielen. Das hat seine theoretischen, aber auch seine ganz praktischen, phänomenologischen und performativen Aspekte. Das reicht von der Frage nach dem Anfang und dem Ende des Lebens und seiner Definition über die Frage der Zeitwahrnehmung und des Zeiterlebens am Lebensende, über Trauerzeiten und Fragen der zeitlichen Reichweite finanzieller Absicherung für die Hinterbliebenen bis hin zu der Festlegung zeitlicher Normen für die Rettungsdienste, um zum Beispiel Schlaganfallpatienten möglichst frühzeitig in eine Stroke-Unit im Kreiskrankenhaus einliefern zu können.
Nicht selten geht es um Sekunden, wenn Leben oder Tod auf dem Spiel stehen – sei es um die Sekundenbruchteile, die wir übermüdet im Auto eingenickt sind oder in denen sich der Radreifen eines ICE gelöst hat, der dann am Brückenpfeiler zerschellt. Manchmal sind es Minuten, die den Unterschied machen, ob jemand nach einem Schlaganfall rechtzeitig die Stroke-Unit des nächsten Krankenhauses erreicht, manchmal sind es Stunden oder Tage, die den moribunden Patienten vom Übergang ins Reich des Todes trennen, manchmal sind es Jahre, die die spätere Trauer anhält. Immer ist es die Zeit, die Lebenszeit, die uns von Gott oder wem auch immer geschenkt oder anvertraut wurde, die damit aufhört, zu existieren. Damit endet unsere Selbstbestimmung über die eigene Zeit und unser Recht auf eigene Zeit, der Genuss von Zeitwohlstand, der zeitliche Stress, die Langeweile, die Erwartungen an die Zukunft. Und wenn man den einen glauben darf, ist damit alles Zeitliche am Ende; die anderen behaupten, dass jetzt erst die schönste Zeit beginnt, an Gottes Seite im Reich der Ewigkeit.
I. Zeit, Leben, Tod
Dass das Leben Zeit ist und die Zeit nicht ist ohne Leben, zumindest nicht ohne Bewegung, erscheint als eine Binsenweisheit, zumindest für den/die sozialwissenschaftlichen Zeitforscher:in. Aber was bedeutet dann diese Grenze zwischen Zeit und Nicht-Zeit für diejenigen, die unsere Welt gezwungenermaßen oder freiwillig verlassen und auf der anderen Seite für diejenigen, die dabei sein müssen oder wollen, wenn es ans Sterben geht, für die Angehörigen, die medizinischen Begleiter und die Begleiter für die Angehörigen der Sterbenden? Was bedeutet der Tod als Zeitproblem in der modernen Gesellschaft? Was bedeutet der Vorgang des Sterbens als Vorgang in der Zeit für diejenigen, die es passiv erleiden und diejenigen, die dabei sind?
„Lebensspanne“ ist ein Begriff, der deutlich macht, wie sehr unser Leben mit dem Faktor Zeit verbunden ist. Wir wissen zwar, wann das Leben beginnt – aber ehrlicherweise nur ungefähr, wenn man an die Diskussionen um die Legitimität und Legalität von Schwangerschaftsabbrüchen denkt. Und wir wissen auch nicht exakt, wann es endet, wie groß also unsere Lebensspanne genau sein wird. Denn die präzise Bestimmung des Todeszeitpunkts ist ähnlich uneindeutig wie die des Lebens. Wir kennen die Lebensspanne, den Todeszeitpunkt, wenn wir unser Leben auf eigenen Entschluss verkürzen wollen, entweder weil wir das Leben nicht mehr aushalten wollen, wie es ist, oder weil wir, von schwerer Krankheit gezeichnet, eine medizinisch mögliche Lebensspanne nicht aushalten wollen, wenn uns also die Qualität unserer Lebenszeit wichtiger ist als deren Quantität. Haben wir überhaupt das Recht, über die Dauer unseres Lebens zu befinden oder gibt es eine höhere Macht, die hier die Prärogative hat? Während Selbstmörder früher nicht einmal auf dem christlichen Friedhof begraben werden durften, billigt eine freiheitliche Gesellschaft ihren Mitgliedern das Recht zu, auch hier weithin selbstbestimmt zu entscheiden. Und weiter zum Stichwort Lebensspanne: Wollten nicht alle Menschen zu allen Zeiten, dass sich die menschliche Lebensspanne verlängert? Mit möglichen 800 Jahren bewirbt sich eine politische Partei regelmäßig um Mandate im Bundestag. In der einigermaßen seriösen Fachliteratur, die sich mit den Möglichkeiten und Grenzen der kollektiven Lebensverlängerung beschäftigt, wird inzwischen eine Erweiterung der Lebensspannen auf bis zu 150 Jahre diskutiert.
Lebensspanne beinhaltet aber auch das Gegenteil, nämlich den Senizid, das heißt die freiwillige oder erzwungene Tötung alter Menschen in vorindustriellen Gesellschaften bzw. bei sogenannten Naturvölkern, deren natürliche Ressourcen regelmäßig nicht ausreichten, um den gesamten Stamm zu ernähren. Für alte Menschen war es dann üblich, freiwillig oder gezwungen aus dem Leben zu scheiden. Verbreitet sind hier etwa die Suizide bei der indigenen Bevölkerung Nordamerikas in vorigen Jahrhunderten, bei denen sich die Alten von einem Felsen in die Tiefe stürzten.
II. Bestattung
Die kulturellen Unterschiede im Umgang mit dem Tod sind weltweit gewaltig. Und sie schreiben sich weiter fort mit der modernen Entwicklung hin zu einer postindustriellen, weithin säkularisierten, andererseits mit neuen religiösen Energien aufgeladenen, diversen Gesellschaft. Immer spielen dabei spezifische Zeitlichkeiten eine besondere Rolle. Ob und ggf. wie lange darf oder soll der Leichnam aufgebahrt werden? Welche Rituale sind zu beachten? Wie lange darf die Zeitspanne zwischen Tod und Beerdigung sein? Welche Formen der Bestattung sind zulässig und welche Zeitabläufe sind damit verbunden? Und wie verändert sich das alles im historischen Verlauf?
Das erste Krematorium in Deutschland nahm 1878 in Gotha seinen Betrieb auf und darf als Ausdruck der weiteren Durchsetzung von Säkularisierung und neuer Weltanschauungen im sich modernisierenden Kaiserreich betrachtet werden, nachdem vormals die Kirchen die Regeln bestimmt hatten. Noch 1886 untersagte Papst Leo XIII. den katholischen Christen die Urnenbeisetzung. Heute bestätigen Bestatter in den urbanen Zentren, insbesondere mit hohem Zuwandereranteil wie auch mit einem hohen Anteil an grün-alternativer Lebenskultur, dass die traditionellen, von der alten kirchlichen Leitkultur geprägten Bestattungsrituale weiter ihre Prägekraft verlieren. Auch die tradierten Rituale der Zuwanderungskulturen verlieren an Bedeutung, so wie infolge der Individualisierung der Gesellschaft neue, großenteils privat kreierte Rituale entstehen.
In der christlichen Religion hat der Glaube an die Auferstehung über Jahrhunderte zu einer Relativierung des diesseitigen Lebens, der Lebensspanne auf dieser Erde, geführt. In verschiedenen Dogmen der unterschiedlichen christlichen Konfessionen und Denominationen wurde, zumindest in der traditionellen Sichtweise, das menschliche Sein im Hier und Jetzt als Bewährungsprobe für das eigentliche Ziel des Lebens, in das Reich Gottes zu gelangen, angesehen. Die Erdbestattung als die Norm des genuin christlichen Begräbnisses ist eine der Konsequenzen
daraus, indem die Erhaltung des Leibes als Leichnam nach traditionell christlicher Vorstellung eine Voraussetzung für die Auferstehung ist, so wie sie nach dem Neuen Testament bei der Auferstehung Jesu gleichsam vorexerziert wurde.
In bestimmter Weise hat die christliche Sicht auf die Welt und ihr Verhältnis zu Leben und Tod nachhaltig die gesamte westliche Zivilisation geprägt. Max Weber hat dies in seiner berühmten Protestantischen Ethik als Antrieb der Menschen im Einflussbereich der Calvinistischen Ethik zu einem historisch einmaligen, namentlich besonders rechenhaften Umgang mit der Zeit verantwortlich gemacht.
Auffällig sind etwa auch die Totenkulte in Mittelamerika, die als fröhliche Feste zelebriert werden und mit der Vorstellung verbunden sind, dass mit dem leiblichen Ableben nahestehender Menschen noch längst nicht alle Möglichkeiten abgebrochen sind, mit diesen zu kommunizieren. Ähnliche Rituale finden wir, hier im täglichen Gebrauch, mit den Hausschreinen des Shintoismus etwa in Japan. Das Ende der Lebensspanne des leiblichen Lebens bedeutet hier also nicht das Ende der Zeitspanne, innerhalb derer eine Kommunikation mit den Verstorbenen möglich ist.
III. Sterben als Prozess
Bisher war viel vom Tod die Rede und nur wenig vom Sterben als einem zeitlichen Prozess – einerseits in medizinisch-physiologischer, zum anderen in sozialer Hinsicht. Das Sterben kann ein plötzliches oder ein sich lang hinziehendes Ereignis sein. Sterben meint substanziell den Übergang von einem in den anderen Zustand – man kann auch sagen, der Begriff des Sterbens bezeichnet eine Übergangszeit. Übergänge sind immer kritisch. Sie sind, anders ausgedrückt, Krisenphänomene. Wobei hier in mehrerlei Weise mit zeitlichen Kontingenzen zu kalkulieren ist. Denn nicht immer ist klar, ob der sich verschlechternde Zustand tatsächlich der Weg eines moribunden Menschen ist oder letztlich doch nur eine Krise im Sinne der perspektivischen Wiederherstellung eines vitalen Zustands im Durchlauf durch einen vorläufigen Zusammenbruch. Das wirft sowohl physisch-medizinische als auch psychosoziale Probleme auf. Stichworte sind hier Sterbebegleitung und Palliativmedizin. Medizinisch löst die Aussage eines Arztes, der Patient sei austherapiert und eine Ausbreitung der Erkrankung bis hin zum Tode nicht mehr aufzuhalten, zuerst die Frage nach der noch zu erwartenden Lebensspanne aus: Wie viele Tage, Wochen, Monate oder gar Jahre sind noch erwartbar? Und wie kann man eine solche Nachricht als Betroffene(r) überhaupt verkraften?
Medizinisch stellt sich hier das ethisch höchst diffizile Problem des Arztes, zwischen Akut- und Präventivmedizin entscheiden zu müssen, ob zum Beispiel eine therapeutische Maßnahme wie eine teure Krebstherapie infolge nicht erkennbarer Erfolge vertretbar ist oder nicht. Das ist wesentlich bedingt durch wirtschaftliche Restriktionen, die aus nachvollziehbaren Gründen durch die Vorgaben der Krankenkassen gesetzt sind. Im weiteren Sinne sind Regeln wirksam, die zum Beispiel bestimmte Therapien und medizinische Eingriffe an das Lebensalter der Patient:innen binden – alles mit dem an sich nachvollziehbaren Ziel, ein für alle Mitglieder der Gesellschaft zugängliches Gesundheitssystem aufrechterhalten zu können. Statistische Einsichten führen dann also zu Restriktionen bezüglich der Dauer von Behandlungen oder auch des Beginns medizinischer Behandlungen. Und dies wirkt wieder – wie schon beschrieben – auf die erreichbare Lebensspanne der Betroffenen zurück.
IV. Zeitlichkeiten des Sterbens und der Begleitung
Bei den sozialen Aspekten des Sterbevorganges ist zu unterscheiden zwischen der betroffenen Person selbst und den ihr nahstehenden Menschen, die von ihrem Hingang in irgendeiner Weise lebensweltlich oder psychisch tangiert sind. Was den/die Betroffene angeht, eröffnet das Sterben einen neuen, bislang nicht oder nur theoretisch bekannten zeitlichen Horizont. Über diesen spiegelt sich das Handeln des Sterbenden in der unmittelbaren Gegenwart. Je nach Schwere der Erkrankung ist ein zeitlicher Horizont durch den Sterbenden nicht mehr wahrnehmbar und wird damit zu einer Art erweiterter Gegenwart, die auch das zeitliche Referenzsystem der verbleibenden Alltage bestimmt. Zugleich kann, sofern die zeitliche Wahrnehmung noch intakt ist, ein enormer Zeitdruck entstehen. Dieser äußert sich unter anderem darin, seine letzten Dinge zu ordnen, ggf. Erbschaften zu organisieren, die berühmte Bucket-List (aller-)letzter Wünsche zu erfüllen oder noch ein letztes Mal all diejenigen Menschen zu treffen, von denen sich persönlich zu verabschieden man für wünschenswert hält. Die Zeiträume hierfür können sehr unterschiedlich sein, je nachdem, wie schnell das Ende „in Sichtweite gerät“ – in Abhängigkeit von den Prognosen für das erwartete Ende. Nicht selten aber lässt der plötzliche Tod überhaupt keine Zeit mehr für eine Beeinflussung der sozialen Prozesse des engeren Lebensumfeldes oder für die Abarbeitung von Wünschen.
Im Gegensatz zu einem entstehenden Zeitdruck kann sich auch eine Phase großer zeitlicher Gelassenheit ergeben, sofern die erkrankte Person als moribund ausgewiesen ist und aus dem System der medizinischen Versorgung zu Heilzwecken in das System der Palliativversorgung beziehungsweise der Palliativpflege im Hospiz übergeht. Hier stoßen wir dann schnell an die Grenzen, aber auch die Möglichkeiten struktureller Rahmenbedingungen von Tod und Sterben im modernen Wohlfahrtsstaat. Und hier sind Zeitlichkeiten wesentlich für die Frage eines humanen Umgangs mit der allerletzten Lebensphase mitverantwortlich. Denn während in der Phase der normalen, fristfreien Pflegebedürftigkeit allen Kritiken aus Forschung und medialer Öffentlichkeit zum Trotz die so genannte Minutenpflege, das heißt eine nach tayloristischen Prinzipien und damit streng an Zeitvorgaben orientierten Pflege gängige Praxis ist, scheint die Bedeutung von Zeit im Raum der Palliativmedizin zu großen Teilen fast suspendiert. Das gilt sowohl für die Frage der Zeitpunkte von Einsätzen von Ärzten und Pflegepersonal als auch, sehr wichtig, in Bezug auf die Dauer der Einsätze für die medizinische, pflegerische und psychosoziale Unterstützung. Auch wenn einzelne Erfahrungen dagegen sprechen können, scheint es an dieser Stelle doch gelungen zu sein, Strukturen zu etablieren und passendes Personal zu rekrutieren, um den Aufgaben, die sich im Umgang mit Menschen in der Sterbephase stellen, entsprechen zu können.
Eine dritte Kategorie ist das selbstbestimmte Sterben im Sinne einer organisierten bzw. assistierten Sterbehilfe durch Dritte. Selbstbestimmtes Sterben heißt zumindest idealtypisch Selbstbestimmung über den Sterbezeitpunkt. Dem eigenen Leben ein bewusstes Ende zu setzen, weil man es nicht mehr für lebenswert hält, gehört zu den exponiertesten Fällen eines Rechts auf eigene Zeit, das bei einem gemeinsamen freiwilligen Sterben eines Paares auch die Dimension des Rechts auf eine gemeinsame Zeit umfasst.
V. Zeithorizonte von Abschiednehmen und Trauer, Totengedenken
Für die An- und Zugehörigen sterbender Menschen bedeutet das Sterben eine unwiderrufliche Limitierung des Zeithorizonts bezogen auf die Interaktion. Das hat unterschiedliche Implikationen.
Die letzte Zeit kann noch einmal eine sehr intensive Zeit des Miteinanders werden, die die Beziehung vertieft, oder sie kann die Chance bieten, Ungeklärtes zu bereinigen, Unversöhntes zu versöhnen, Konflikte noch zu lösen. Damit ist zuweilen ein intensives Zeiterleben, eine Art Flow verbunden, ein Überschreiten der alltäglichen Zeiterfahrung.
Trauer beinhaltet auch die Frage nach dem Ort, an dem der/die Verstorbene sich nun aufhalten mag. Für viele Hinterbliebene ist es eine große Hilfe, einen physischen Ort zu haben, mit dem sie den Toten/die Tote irgendwie in Verbindung bringen können. Traditionell ist dies eine nach Stand und Portemonnaie möglichst ästhetisch ausgestaltete Grabstelle. Immer öfter jedoch wünschen sich die Versterbenden eine anonyme Ruhestätte mit Wald-Atmosphäre.
In der zeitlichen Dimension ist Trauer sehr viel unkonkreter. Sie entzieht sich nicht nur in zeitlicher Hinsicht fast vollkommen der Kontrolle der trauernden Person. Weder kann diese die Zeitpunkte bestimmen, zu denen und aus welchen Anlässen das Gefühl des Schmerzes aufkommt, noch erst recht nicht die Dauer des schmerzhaften Erinnerns: Die Trauer selbst bestimmt, wie viele Tage, Monate oder Jahre sie sich bemerkbar macht und wie heftig in welchen Perioden ihre Ausschläge sind. Hierzu haben sich professionelle Seelsorger:innen immer wieder geäußert.
In den Phasen der Trauer trifft der seelische Zustand der Trauernden oft hart auf die Wirklichkeit des Alltagslebens. Die häufige Inkompatibilität mit der modernen Lebenswelt wird u. a. deutlich, wenn die zeitlich unterschiedlich gelagerten und nur bedingt vorhersehbaren Phasen der Trauer auf die Ansprüche einer noch weithin getakteten und in ihren Leistungsanforderungen unerbittlichen Arbeitswelt treffen. Die vorfindlichen Regelungen nehmen auf Trauerphasen nur selten genügend Rücksicht, nicht nur was ihren Umfang, sondern auch was ihre Flexibilität betrifft.
Der Umgang mit dem toten Körper, Trauer, Bestattung und die damit verbundenen Tätigkeiten und Rituale sind gesellschaftlich und teilweise rechtlich weitreichend normiert und unterscheiden sich wie eingangs gesagt zwischen Religionen und Gesellschaften beträchtlich. Selbst die Trauerorte haben unterschiedliche zeitliche Regeln. In der mitteleuropäischen Tradition wird ein Grab für eine bestimmte Dauer (mit Verlängerungsmöglichkeit) gemietet oder gekauft, während in anderen religiösen Traditionen ein Grab im Prinzip auf ewig Bestand haben muss. Indem zunehmend anonyme Bestattungen – z. B. in Friedwäldern oder durch Verstreuen der Asche im Meer oder der Natur – gewählt werden, werden Trauer und Gedenken völlig von einem spezifischen Ort gelöst.
Die üblichen Trauerzeiten, die den Hinterbliebenen zugebilligt werden, sind je nach Gesellschaft unterschiedlich durch Konvention normiert. In unseren Breiten ist das Trauerjahr eine noch bekannte Zeitnorm. Werden solche in einer Gesellschaft für üblich erachteten Trauerzeiten überschritten, wird dies anhand spezifischer Kriterien als psychisch-pathologischer Befund gewertet, der einen Behandlungsbedarf signalisiert.
Eine weitere zeitliche Dimension stellt die Begehung von Gedenktagen dar. Dabei muss man zwischen individuellen und kollektiven Gedenktagen unterscheiden. Die individuellen Gedenktage sind in der Regel das Todesdatum einer gestorbenen Person, die man in privaten Rahmen oder etwa durch einen individuellen oder gemeinschaftlichen Gedenkgottesdienst begehen kann. Kollektive
Gedenktage für die Toten einer Gemeinschaft, etwa der Totensonntag, Allerseelen, Volkstrauertag, sind mit jeweils spezifischen Ausrichtungen verbunden. Gedenktage, die noch einmal spezifisch zu diskutieren wären, sind die Gedenktage für die Gefallenen in Kriegen.
VI. Schneller und langsamer Tod
Was ist, wenn dem Tod nicht eine lange Pflegezeit vorangeht, sondern die Polizei mit der Nachricht von einem Verkehrsunfall vor der Tür steht? Wenn der Tote Opfer einer Flutkatastrophe geworden ist? Wenn man den Partner nach einem Schlaganfall oder Herzinfarkt morgens tot in der Küche findet? Während bisher von einem langsamen Sterben mit Ankündigung und in Würde gesprochen wurde, sieht die Realität nicht selten grausam aus und die zeitliche Dimension scheint denen, die einen geliebten Menschen plötzlich und überraschend verloren haben, unerbittlich. Das bedeutet für den/die Gestorbenen, keine Zeit mehr gehabt zu haben, um Dinge zu regeln, um noch jemanden um Verzeihung bitten zu können, um auch nur zu spüren, dass man aus der Welt geht. Für die Angehörigen ruft ein solch abruptes Ereignis eine besondere Form des Leidens hervor, die oft organisierter Hilfe bedarf. Denn anders als bei hochbetagten Sterbenden stellt sich hier allein durch den unvorhersehbaren Abbruch der normalen Dramaturgie einer Lebensspanne und ihrer biografischen Sequenzialität die Sinnfrage. Hatte alles seine Zeit? Gibt es Gründe dafür, dass den jungen Opfern der Brandkatastrophe in der Disco die Chance auf ihre Zukunft genommen wurde, das heißt ihre Erwartungen und Träume an das Leben zu erleben? Der plötzliche und damit zumeist irgendwie tragische Tod ruft die Notwendigkeit eines professionalisierten Netzwerkes der psychischen Nach-Betreuung und der Seelsorge hervor. Professioneller Hilfe bedürfen darüber hinaus aber auch diejenigen, die mit dem Retten von Leben beschäftigt sind und sich – nicht selten im Ehrenamt, unter anderem bei den Freiwilligen Feuerwehren – selbst in Lebensgefahr begeben.
VII. Tod und Krieg
Seit ein paar Jahren hat auch unsere Gesellschaft endgültig das lange öffentlich verdrängte Problem erreicht, welche Todesopfer Naturkatastrophen und Kriegseinsätze kosten und – so zynisch das klingen mag – kosten dürfen. Mit der Dauer von Kriegseinsätzen wächst die Zahl der Toten, die zu beklagen sind. In unmittelbaren Kriegssituationen ist dann auch von der „Höhe des Blutzolls“ die Rede, der auf eine Sinnstruktur und eine gesellschaftliche Rechtfertigungsordnung bezogen werden muss, die die Risiken des Todes im Kampfeinsatz mit den ethischen Maximen einer Gesellschaft in Einklang bringen kann. Wenn die Zeit drängt, muss über Tod und Leben nach ethisch vereinbarten Regeln entschieden werden. Der Begriff der Triage reguliert die Behandlungsdringlichkeit, das heißt die auch zeitliche Priorisierung von Behandlungen. Das bedeutet jedoch auch, unter den Bedingungen defizitär verfügbarer Ressourcen für die Rettung bei im Zeitverlauf lebensgefährdeten Personen diese denen zukommen zu lassen, deren Überlebenschancen von der jeweiligen Rettungskraft als medizinisch am höchsten eingeschätzt werden. Zusammenfassend muss man feststellen, dass Krieg und Sterben im Krieg die Extremform des Verlustes an zeitlicher Selbstbestimmung darstellen.
VIII. Tod in jungen Jahren
Es sind aber nicht nur ältere Menschen, die mit Tod und dem Sterben zu tun haben: Eltern verlieren ihre Kinder, Kinder verlieren früh ihre Eltern. Die Generationalität des Todes und nicht weniger des Sterbens ist ein weiterer Aspekt von Zeitlichkeit im Rahmen unseres Themas. Von Eltern, die erleben müssen, dass ihre Kinder nicht in der genealogisch normalen Reihenfolge aus der Welt gehen, weiß man, in welcher Weise sie von Schuldgefühlen gepeinigt sind, nicht selten lebenslang. Umgekehrt fühlen Kinder sich von ihren Eltern alleingelassen auf dem Weg ins Leben, wenn diese „vorzeitig“ versterben. Es bleibt eine Herausforderung, jungen Menschen, auch wenn sie nicht unmittelbar vom Tod betroffen sind, die Faktizität des Sterbenmüssens so zu erklären, dass sie die eigene und die Allgemeine Begrenztheit der Lebensspanne als Conditio humana begreifen und nicht als Strafe einer höheren Macht oder Fehlkonstruktion des Lebens, der man mit allen Mitteln widerstreben muss.
IX. Jenseits oder Nichts
Für Angehörige ist die Frage danach, wo eigentlich der geliebte, manchmal aber auch der gehasste oder indifferent betrachtete Angehörige nach dem Prozess des Sterbens, wenn die Beerdigung vorbei ist, abbleibt, eine Frage, die jede Menge zeitliche Implikationen hat oder zu haben scheint. Sie kann hier jedoch nicht weiter vertieft werden. Auf die unterschiedlichen weltanschaulichen Perspektiven
und die interkulturellen und interreligiösen Fundierungen der Antworten auf die eschatologische Dimension von Tod und Sterben wurde eingangs hingewiesen.
Dr. Jürgen P. Rinderspacher,
Mitglied der DGfZP,
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler